
DER SPIEGEL 16-1980 (S.164-177)
DER SPIEGEL 17-1980 (S.156-167)
DER SPIEGEL 18-1980 (S.205-216)

* An einer Hauswand in Pnom Penh
„Ich höre noch Schreie in der Nacht"
SPIEGEL-Redakteur Tiziano Terzani im zerstörten Kambodscha
Kambodscha von heute fordert die Phantasie des Schreckens heraus. Ich hatte das
Land im Jahre 1975 verlassen, kurz bevor die Roten Khmer Pnom Penh übernahmen.
Ich hatte ein Kambodscha verlassen, das Krieg führte, aber immer noch lebendig
war; mit Städten, mit normalen Menschen, vielen Freunden.
Ich kam zurück und fand nur noch die Skelette der Gebäude und der Menschen
wieder, die ich gekannt hatte.
Kambodscha sieht heute wie ein Land aus, das von allen gottgesandten und
menschengemachten Missgeschicken heimgesucht wurde, von Pest und Krieg, Erdbeben
und Neutronenbomben.
Seit Oktober 1975 hatte ich in thailändischen Flüchtlingslagern und später,
1978, auch in südvietnamesischen Berichte über die Pol-Pot-Massaker gehört, aber
mein Verstand konnte die Dimensionen jener Realität nicht erfassen.
Ich verbrachte 17 Tage in Kamputschea. In einem Fiat sowjetischer Bauart fuhr
ich über 1500 Kilometer durch zehn der 19 kambodschanischen Provinzen auf
Straßen, die von amerikanischen Minen zerbombt und von den Roten Khmer niemals
repariert worden waren.
Überall wo ich anhielt, manchmal rein zufällig wegen Reifenschadens oder um
Kokosnußsaft zu trinken, fand ich Massengräber und Vernichtungsfelder. Manchmal
ließ es sich nicht vermeiden, über Knochen von Menschen zu gehen, die zwischen
1975 und 1978 umgebracht worden waren.
In Pnom Penh war ich stundenlang mit dem Fahrrad unterwegs und suchte nach
Plätzen, die ich kannte, nach Häusern, in denen ich gewohnt hatte, nach alten
Freunden. Ich konnte nichts und niemanden finden. Ich hielt Ausschau nach meinem
alten Dolmetscher,
aber von dessen ganzer Familie gab es nicht eine einzige Spur, ausgelöscht.
Statt dessen sah ich einige vietnamesische Vietcongbekannte, die ich nach der
kommunistischen Machtübernahme in Saigon getroffen hatte und die jetzt zu der
Besatzungs-Armee gehören, die Hanoi in Kam-putschea unterhält.
|
|
Kambodscha 1980: In der Einsamkeit des Dschungels, hoch über den Zuckerpalmen,
bücken rätselhafte Gesichter mit unruhigem Lächeln hernieder, die riesigen
Steinfiguren der Tempelstadt Angkor Wat. An den Wänden der Tempel und Paläste
berichten riesige Flachreliefs von großen Schlachten, die die Kräfte des Lichtes
und der Finsternis gegen-einander schlugen, von schrecklichen Folterungen, von
erschlagenen, zerstückelten Menschen.
Eine Inschrift lautet: „Der Wissende betrachtet das Leben als ein flackerndes
Licht, bewegt von einem heftigen Wind."
All dies wurde vor nahezu tausend Jahren geschrieben und geschnitzt als eine
Warnung an die Menschen. Es sieht jetzt aus wie eine gespenstische Prophezeiung.
Nur vier Kilometer weiter, vor den verrußten Ruinen des ehemaligen Gymnasiums
von Siem Reap, bleichen die Reste Hunderter Menschen, die geschunden,
erschlagen, zerstückelt wurden, in der sengenden Sonne.
Die unglücklichen Nachkommen der Erbauer dieses Monuments kratzen jetzt die
Steine von Angkor ab und sammeln die Exkremente der Fledermäuse, um sie als
Dünger zu benutzen, und sie scharren in den Massengräbern. Einige suchen nach
ihren Angehörigen, andere suchen in den Falten der vermoderten Hemden nach
verstecktem Gold.
Von oben lächeln die steinernen Gesichter der Gott-Könige mit halbgeschlossenen
Augenlidern unentwegt und umbarmherzig auf die Menschen nieder, die so töricht
sind zu glauben, in der Geschichte gebe es einen Fortschritt.
Man hört das Lachen der Affen und das Klagen der Zikaden. „Sie schreien, weil
die Trockensaison alle Blätter abgetötet hat, aber ich habe das Gefühl, daß sie
schreien, weil so viele Khmer tot sind", sagt der Kurator der Tempelstadt Pich
Keo, der fünf Schwestern, einen Bruder, beide Elternteile und einen Sohn in den
Massengräbern weiß.
Der Wächter Angkor Wats führt mich durch die Ruinen des alten Khmer-Reiches, die
an die vor langer Zeit eingefallenen Armeen aus dem Westen und Osten erinnern,
und durch die neueren Ruinen, die der schreckliche Schicksalsgott namens Pol Pot
zurückließ.
|
|
* An dieser Stelle wurden etwa 20 000 Kambodschaner von den Roten Khmer hingerichtet


1970 lebten 36 Archäologen in Kambodscha. 21 wurden umgebracht, 12 sind in
Paris, Pich Keo ist einer der drei, die blieben. Seine Bücher wurden vernichtet,
alle Dokumente von Angkor verbrannt, und wie alle überlebenden Kambodschaner,
die ich traf, kann auch er kaum den Mut zu einem Neubeginn aufbringen.
Die Leute gehen in ihre Häuser zurück, aber finden leere Gemäuer vor, die Frauen
gehen zu den Brunnen, aber finden kein Wasser; auf dem Grund liegen verwesende
Leichen. Die Männer versuchen, die Reisfelder zu pflügen, aber graben Skelette
aus. Wie die Bauern in anderen Ländern, die Steine von ihren Äckern klauben,
sammeln die kambodschanischen Bauern Schädel auf und arbeiten weiter.
Ein gelähmtes, verzweifeltes, gebrochenes Volk von Witwen, Waisen und wenigen
noch lebenden terrorisierten Männern wandert umher, sammelt die Stücke seines
Unglücks und sucht den verlorenen Faden des Lebens wiederaufzunehmen.
Überall haben kleine Märkte wieder geöffnet, die Kinder spielen auf Bergen von
Abfall, zerbrochene Buddhas werden unter Strohdächern gesammelt, das alles an
Plätzen, wo einst eine Pagode stand, die von den Roten Khmer dem Erdboden
gleichgemacht wurde.
|
|
Kambodscha lebt wieder, allerdings unter dem Schutz der Armee traditioneller
Feinde, die sich jetzt als Freunde bezeichnen und denen die Leute für ihr
Überleben danken müssen.
„Wenn sie nicht gekommen wären, wäre ich im vergangenen Jahr gestorben. Wenn sie
gehen, werde ich im nächsten Jahr sterben", sagt Rim Rom über die Vietnamesen;
ein früherer Student, der jetzt als Dolmetscher im Außenministerium arbeitet.
Acht Mitglieder seiner Familie kamen um.
In Kambodscha stehen derzeit mindestens 200 000 vietnamesische Soldaten, sie
sollen garantieren, daß Pol Pot nicht an die Macht zurückkehrt und Kambodscha zu
einer gewissen Form von Normalität zurückfindet.
Pnom Penh soll das Symbol dieser Wiedergeburt Kamputscheas sein. In der Stadt
selbst wohnen heute wieder 120 000 Menschen, weitere 130 000 leben in der
Umgebung. An den Einfahrtstraßen wird niemand kontrolliert. Nur wer in der Stadt
ständig wohnen will, muß einen Arbeitsplatz nachweisen, gewöhnlich erhält er ihn
von der Regierung.
Bald nach dem 7. Januar 1979, als die vietnamesische Armee in Pnom Penh
einmarschierte und Pol Pot stürzte, stellte die neue Regierung des Präsidenten
Heng Samrin jeden an, der sich in Pnom Penh meldete und gewisse Fertigkeiten
vorweisen konnte.
Der Monatslohn betrug zunächst 15 Kilogramm Reis, später 18 Kilogramm. Jetzt
wurde eine neue Währung eingeführt, die Banknoten kamen frisch aus sowjetischen
Druckereien. Da erhält ein Staatsangestellter dann 60 Riel, wobei ein Riel einem
Kilogramm Reis oder 25 Zentimeter Stoff entspricht.
Ein Arbeitsplatz berechtigt auch zu einer Unterkunft, aber die früheren
Einwohner Pnom Penhs durften nicht einfach in ihre Häuser zurückkehren. Die
Stadt wurde in Abschnitte aufgeteilt und jedem Ministerium ein Stadtteil in der
Nähe als Wohnquartier für die eigenen Mitarbeiter zugewiesen.

Große frühere Wohngebiete blieben vietnamesischen Soldaten und Kadern
reserviert. Ein quer über die Straße gelegter Bambuspfahl und ein
vietnamesischer Posten in einer Holzkabine markieren das Gebiet, das kein
Kambodschaner betreten darf. Während einige Stadtteile am Rande noch
gespenstisch aussehen, verdecken im Zentrum Pnom Penhs große Beete mit
überschwenglichen Bougainvilleas und Mimosen einfach einige der schlimmsten
Narben.
Die größten Boulevards sind nach zwei früheren kambodschanischen KP-Führern
benannt, die beide getötet wurden, einer angeblich von den Chinesen, der andere
von Pol Pot. Und das alte Hotel „Royal" wurde jetzt in „Samaki" (Solidarität)
umbenannt.
Die Kokospalmen, die die Roten Khmer mitten auf den Gehwegen pflanzten,
verbergen hinter ihrem prächtigen Grün einen Teil der Zerstörung. „Sehen Sie
nicht, daß diese Kokospalmen größer sind, als es eigentlich ihrem Alter
entspricht?" fragt mich mit einem verängstigten Bück in den Augen der
Dolmetscher Run Rom: „Sie haben einen besonderen Dünger erhalten."
Unter Pol Pot war es verboten, Leichen einzuäschern. „Holz ist dazu da, um Feuer
zum Kochen zu machen, und sollte nicht verschwendet werden", pflegten die Roten
Khmer zu sagen. So begruben sie ihre Opfer zusammen mit Samen der Kokospalmen.
„Ich betrachte die Kokospalmen und habe noch im Ohr, wie die Tschhlop (die
jungen Garden der Roten Khmer) mir zuflüsterten: ,Gute Kokosnuß, gute Kokosnuß,
töten, um einen guten Kokosnußbaum zu bekommen...'", sagt Rim Rom, der zwei
Jahre auf einer Kommune in Svay Rieng arbeitete.
Ständig wurde er daran erinnert, daß er immer noch einen guten Dünger abgeben
würde, wenn er als Arbeitskraft nicht mehr tauge. Jetzt glaubt er wie viele
andere Kambodschaner, unter jeder „Pol-Pot-Kokospalme" liege eine Leiche.
Tausende dieser Bäume wachsen in jeder verlassenen Stadt und in jedem
verlassenen Dorf Kambodschas. Der frühere Zentralmarkt von Pnom Penh, der noch
geschlossen ist, liegt hinter einem dichten Wald von Kokospalmen versteckt.
Die Regierung Heng Samrin hat sich nach einem Jahr zumindest den Anschein von
Normalität und Leistungsfähigkeit gegeben.
Die Nationalbücherei — unter Pol Pot ein Stall für Schweine — wurde
wiedereröffnet mit Büchern, die man im Garten verstreut gefunden hatte, und mit
dem, was noch vom alten buddhistischen Institut übriggeblieben war. Dessen
unersetzliche Sammlung alter Manuskripte hatten die Pol-Pot-Leute in den Mekong
geworfen.
Jouk Kun, ein früherer Universitätsprofessor, dessen Frau, sechs Kinder und fünf
Brüder unter Pol Pot hingerichtet wurden oder den Tod fanden — einer wurde
getötet, weil er „dick" war und daher eindeutig ein Bourgeois —, arbeitet an
einem neuen Katalog: „Wir haben wenigstens die Regale", sagt er. „Die Roten
Khmer benutzten sie zum Aufbewahren ihrer Kochtöpfe und Reisschüsseln."

|
|
* Beim Fahneneid in Pnom Penh
Das Hauptpostamt wurde in seinem alten französischen Kolonialgebäude
wiedereröffnet und nimmt Briefe ins Ausland entgegen. Aber es gibt keine
Briefmarken. Von den früher 1700 Angestellten haben sich 85 zur Arbeit gemeldet.
Das alte berühmte Nationalmuseum in Pnom Penh ist wiedereröffnet, obwohl alle
hölzernen Exponate, selbst alte Waagen und Spieße fehlen. „Die Khmer Rouge
benutzten sie zum Feuermachen", sagt Taou Sun Heng, ein früherer Student der
Archäologie, der jetzt das Museum leitet.
Statuen und Bronzegeräte sind noch an ihren Plätzen, die meisten haben weiße
Farbflecken. Die Roten Khmer wollten das Museum als Schaustück für Ausländer
wiedereröffnen und versuchten es neu zu streichen. Doch statt des traditionellen
Kalks benutzten sie Ölfarbe, die überall hintropfte. „Wir brauchen Hilfe, um die
Statuen zu säubern, ohne sie zu beschädigen", sagt der Kurator.
An der Universität hat nur die medizinische Fakultät ihre Vorlesungen
wiederaufgenommen. Es sind nur noch einige Bücher vorhanden und nur sieben der
ehemals 70 Professoren. Von den über 500 Ärzten, die 1975 in Kambodscha lebten,
haben sich nur 56 zur Arbeit gemeldet.
Einen 57. entdeckte ich zufällig in einem Dorf Ostkambodschas. Aber er weigert
sich, wie viele andere Intellektuelle, seine Identität zuzugeben. „Bitte, bitte,
sagen Sie niemandem, wer ich bin", bat er mich. Leute seiner Art haben unter Pol
Ppt nur überlebt, weil sie vorgaben, sie seien Analphabeten. Jetzt tun sie sich
schwer zu glauben, daß alles vorüber sei.
„Seit 1975 habe ich nichts gelesen, nicht ein einziges Wort geschrieben. Ich
weiß nicht, wer ich bin", sagt die Kambodschanerin Tschham Tschhajasi (Ehemann
und zwei Kinder tot), die ich über den Markt von Sisophon stolpern sah. Sie war
im Orchester von Pnom Penh Flötistin.
In Pursat sah ich an einer Straßenecke in der Mitte eines Niemandslandes eine
zitternde Frau, die vor vier kleinen Reiskuchen kauerte, die sie zum Verkauf
anbot. „Bonjour Madame", sagte ich.
Sie blickte mich an, als sei ich eine außerirdische Erscheinung, und stammelte
langsam: „Bonjour Monsieur." Ith Sithon, die einzige Überlebende einer
16köpfigen Familie, war früher Lehrerin in Pnom Penh. Ihr Mann wurde vor ihren
Augen erschlagen, weil er ein Lon-Nol-Offizier war. Ihre sechszehn Monate alte
Tochter starb bald danach an Unterernährung. Obwohl erst 28 Jahre alt, sagte sie
ständig: „Wieder anfangen zu leben — ich weiß nicht mehr, wie man es macht."
|
|
In einem Dorf in der Nähe von Neak Luong an der Straße 1 wurde mir ein Mann in
den zwanziger Jahren gezeigt, der fürchtete, die Roten Khmer würden ihn zwingen
zuzugeben, daß er Student gewesen ist. Deshalb gab er vor, taub und stumm zu
sein. Die Roten Khmer waren seit einem Jahr nicht mehr da, aber er konnte immer
noch nicht sprechen und schien nichts zu hören.
Etwa viereinhalb Millionen traumatisierter, verschreckter Khmer sind in
Kambodscha übriggeblieben. Zumindest ein Drittel ist an Malaria oder Beriberi
erkrankt. Alle haben einmal an Unterernährung gelitten und sind noch schwach und
verwundbar. „.Wir haben es mit einer Bevölkerung zu tun, die keine Belastungen
mehr aushält", sagt ein Uno-Beamter, der in Pnom Penh arbeitet.
In einem Land, das zu Sihanouks Zeiten in jeder Provinzhauptstadt ein
vollausgestattetes Krankenhaus hatte, in jedem Distrikt eine Sanitätsstelle,
vernichtete Pol Pot systematisch jede Spur der westlichen Medizin.
Und da er sich ausschließlich auf traditionelle Praktiken verließ, verwandelte
er sogenannte Waldkrankenhäuser in Warteräume des Todes: Die Lebensmittelration
der Patienten wurde halbiert, junge Bauernkinder führten Operationen aus.
„Eines Tages sah ich, wie die Khmer Rouge ein siebzehnjähriges Mädchen in das
Krankenhaus brachten. Sie war gesund und meinte, sie solle dort als
Krankenschwester arbeiten. Statt dessen sah ich, wie man ihr ein Schlafmittel
verabreichte, sie an den Operationstisch band und wie sie von zwei jungen Ärzten
in Stücke geschnitten wurde.
„Die Stücke wurden später im Garten vergraben", erinnert sich Dr. Hun Tchhen Ly,
der jetzt an dem Krankenhaus in Battambang arbeitet (fünf Brüder, seine Frau und
zwei Kinder wurden getötet). Er sagt auch noch: „Pol Pot war schlimmer als
Hitler, denn er tat das mit seinem eigenen Volk."
Diesem Pol Pot gelang es wenigstens, mit einer Krankheit fertig zu werden, der
Lepra. Er ließ alle Leprakranken ausrotten.
|
|
Seit einem Jahr bemüht sich die Regierung, wieder ein Gesundheitssystem für das
gesamte Land aufzubauen, aber die Schwierigkeiten sind ungeheuer groß. In
Provinzen wie Pursat und Kampong Tschhnang gibt es überhaupt keine Ärzte. Von
internationalen Hilfsorganisationen übersandte Arzneimittel sind zwar
eingetroffen, werden aber wie „Bonbons" (so ein vorübergehend anwesender
ausländischer Arzt) verteilt. Nicht mal Farbe ist vorhanden, um die Wände neu
anzustreichen, die immer noch mit Blut und Exkrementen verschmiert sind.
In Battambang, einer Provinz mit 830 000 Einwohnern, ist der einzige, der
operiert, ein Pfleger. „Ich habe dem Chirurgen von 1968 bis 1975 assistiert, und
ich erinnere mich genau, wie es gemacht wird", sagt Tschuon Bun Thol (der sieben
Mitglieder seiner unmittelbaren Angehörigen verloren hat). Wie alle anderen
Provinzkrankenhäuser hat auch das in Battambang kein Röntgengerät.
„Unter diesen Umständen ist es absurd, von einem Gesundheitsprogramm für
Kamputschea zu sprechen", sagt ein ausländischer Arzt, der gekommen war, die
Situation zu untersuchen und Ratschläge zu erteilen. „Das Beste ist, die
Bevölkerung zu ernähren."
Im Augenblick hungert niemand, nirgends sieht man die wandelnden Skelette, die
noch im Oktober zu Tausenden unter den Flüchtlingen über die
thailändisch-kambodschanische Grenze kamen. Aber die allermeisten der Patienten
in den Krankenhäusern, die ich besichtigte, litten an schwerer Unterernährung,
ebenso wie die Kinder mit aufgeblähten Bäuchen und bräunlichem Haar in den
Dörfern entlang der Straße in Westkambodscha.
Ein ausländischer Fachmann kleidete das in die Worte: „Hinter der Fassade der
Normalität lauert immer noch die Zeitbombe Hunger."
|
|
* Im Toul-Sleng-Gefängnis von Pnom Penh kurz vor der Exekution photographiert
Die Rechnung ist einfach. 1979 wurde in Kamputschea auf einem Viertel des
Ackerlandes Reis gepflanzt. Wegen der schlechten Irrigation, dem Mangel an
Düngemitteln und einer außergewöhnlich harten Dürre brachte die Ernte nur 40
Prozent des erwarteten Ertrages. Die Kambodschaner, die bislang die Massaker,
den Krieg und Hunger überlebt haben, müssen zwischen April und Dezember 260 000
Tonnen importieren, wenn sie unter vertretbaren Bedingungen am Leben bleiben
wollen.
„In der Vergangenheit haben wir uns vom Wald ernährt. Wir werden das wieder
tun", sagt Khunn Thach (sie hat ihren Mann, zwei Schwestern und einen Sohn
verloren), Leiterin des früheren Grand Hotels von Siem Reap, das jetzt verfallen
ist und kein Wasser hat.
Ernährungsexperten sehen die Lage so: Wenn die Menschen wieder Blätter,
Eidechsen und Ratten essen, werden sie nicht in der Lage sein, in der nächsten
Saison wieder Reis anzupflanzen, und so wird der Hungerzyklus niemals aufhören.
Die neuen Herren konnten die Agrarproduktion nicht so schnell wieder in Gang
bringen, vor allem weil die Pol-Pot-Kader das Bewässerungssystem grundlegend
geändert hatten: Sie ließen die Zwangsarbeiter aus den Städten, die aufs Land
geschickt worden waren, riesige Kanäle graben, taten dies jedoch ohne jegliches
Ingenieurwissen, so daß die vielen Deiche brachen, als der Regen kam.
Der Provinz Battambang geht es am schlimmsten. Wie überall im Land erhielt
jeder, der für die Regierung arbeitete, seine Reisration, wer aber nicht für die
Regierung arbeitete, bekam nur ungefähr 700 Gramm im Monat.
1975 liefen in Battambang 500 Wasserpumpen, jetzt sind es nur fünf. Damals
fuhren 1000 Traktoren, jetzt nur 60. Die noch übriggebliebenen Ochsen und Büffel
reichen kaum aus, ein Drittel des Ackerlandes der Provinz zu bebauen.
Ein weiterer Grund für die unzulängliche landwirtschaftliche Produktion: Die
Bevölkerung ist noch nicht wieder seßhaft geworden. Obwohl formell immer noch
Ausgangssperre besteht, hört man nachts in Pnom Penh das Quietschen von Karren,
die langsam durch die unbeleuchteten Straßen geschoben werden. Von Norden nach
Süden, von Westen nach Osten.
Die Menschen ziehen immer noch im Lande umher auf der Suche nach ihren
Angehörigen, auf der Suche nach Dingen, von denen sie hoffen, sie könnten sie
hier und dort wiederfinden.
Vor dem Bahnhof lagern Hunderte und warten, daß ein Zug nach Siso-Som abfährt,
was gänzlich unwahrscheinlich ist. Im ganzen Lande fahren nur noch zwei
Lokomotiven.
Vor dem alten Staatskino habe ich eine Woche lang 400 schmutzige und hungrige
Waisenkinder und Frauen gesehen, die auf einen Lastwagen warteten, der sie in
ihre Dörfer in der Provinz Kampot zurückbringen sollte. Sie waren zu Fuß aus
Pursat eingetroffen, wohin die Roten Khmer sie 1976 getrieben hatten. Die
meisten Männer waren getötet worden.
Vietnamesische Truppen, die in den Dschungelgebieten des Landes Reste der Roten
Khmer verfolgen, finden immer noch Kinderbanden, die im Wald überlebt haben. Die
Soldaten schaffen die Kinder an eine Hauptstraße und sagen ihnen dann, sie
sollen in ihre Geburtsdörfer zurückkehren.
Überlebende verschiedener Familien finden sich oft zusammen. Tscheang Sam Kol
(Eltern, Frau und zwei Kinder verloren), früher Lehrer an einer Grundschule, hat
die Witwe eines Kollegen geheiratet.
In Pnom Penh, wo die Menschen durch die augenscheinliche Rückkehr zur Normalität
wieder Mut fassen, versuchen Mütter, ihre Töchter schon mit 15 Jahren zu
verheiraten, aber es sind nicht genügend junge Khmer-Männer übriggeblieben.
„Warum heiraten Sie nicht einen dieser vietnamesischen Soldaten?" fragte ich ein
paar dutzendmal und bekam immer die gleiche Antwort: „Einen Joun? Nie und
nimmer."
In dem Wort „Joun", einer herabsetzenden Bezeichnung für die Vietnamesen, kommt
die ganze komplizierte Beziehung zwischen diesen beiden Völkern zum Ausdruck,
die seit Jahrhunderten Nachbarn sind und sich seit Jahrhunderten verachten.
|
|
Die Vietnamesen betrachten die Khmer traditionell als ein primitives Volk, die
Khmer wiederum die Vietnamesen als grausam, engstirnig und hinterlistig. „Sie
sagen etwas und meinen es ganz anders."
Neben den mythischen Ungeheuern ihrer Legenden sind die Vietnamesen die bösen
Gestalten in vielen Märchen der Khmer, und es gibt wohl kein Khmer-Kind, dem die
Großeltern nicht die „Teegeschichte" erzählt haben:
Vor langer Zeit gab es einen vietnamesischen König. Er nahm einen Khmer gefangen
und ließ ihn auf einem Deich arbeiten. Der König sagte, er arbeite zu langsam
und müsse bestraft werden. Er ließ ihn bis zum Hals eingraben und setzte einen
Topf mit Wasser auf seinen Kopf, um seinen Tee zuzubereiten. Der König zündete
ein Holzfeuer um den Kopf des armen Khmer an, der begann zu schreien und den
Kopf zu bewegen. Du siehst, sagte der vietnamesische König, ich muß dich noch
stärker bestrafen, weil du mein Teewasser verschüttest.
Seit dem Niedergang des alten mächtigen Khmer-Reiches von Angkor sind die Khmer
immer schwächer, die Vietnamesen immer stärker geworden. In der Mitte des 18.
Jahrhunderts gingen sie daran, das, was von Kambodscha noch übriggeblieben war,
zwischen sich und den Thais aufzuteilen.
|
|
* Lagerbewacher im Photoalbum des Gefängniskommandanten Douch
Die Franzosen, die kamen, um Vietnam zu kolonisieren, beendeten diesen Prozeß
und „schützten" Kambodscha. Jetzt, ein Jahrhundert später, hat die Geschichte
die Vietnamesen wieder nach Kambodscha gebracht. Hanois Propaganda spricht von
den „brüderlichen Beziehungen" zwischen den drei Völkern Indochinas.
Die Franzosen pflegten diese drei Völker so zu kennzeichnen: Die Vietnamesen
bauen den Reis an, die Khmer beobachten, wie der Reis wächst, die Laoten hören
zu, wie der Reis wächst.
Es war immer ein Traum der Vietnamesen, sich ihre wirtschaftliche Basis durch
die Beherrschung ganz Indochmas zu sichern. Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht,
und jeden Morgen preisen die Lautsprecher in ganz Kambodscha die „militante
Solidarität" der drei indochinesischen Völker und die „Liebe der Vietnamesen zu
den Khmer".
„Ja, sie lieben uns, wie der Fuchs die Henne liebt", sagt Khuon Sokour, einziger
Überlebender einer siebenköpfigen Familie. Der frühere Regierungsbeamte verdient
sich jetzt seinen Lebensunterhalt, indem er auf dem Tou-Tam-Pon-Markt westlich
von Pnom Penh Waren kauft und verkauft.
Zwischen Stößen von Abfall und dem Gestank verdorbenen Gemüses herrscht noch die
Atmosphäre der alten Zeit. Die Leute hocken am Boden, essen Nudelsuppe und
Kuchen aus klebrigem Reis. Die Frauen verkaufen alles, von Seife bis zu
Batterien, alte Bücher, die auf den Straßen aufgesammelt wurden, und rote
Saphirringe. Die Mädchen nähen Hemden und Sarongs in schreiendsten Farben:
Violett, Rot, Hellblau, Grün, Reaktion auf das Schwarz der Pol-Pot-Leute.
Schwarze unförmige Anzüge waren die Uniform der Roten Khmer, Schwarz wurde der
gesamten Bevölkerung aufgezwungen. „Ich brauche nur jemanden zu sehen, der sich
schwarz gekleidet hat, und schon zittre ich wie ein Vogel, der in einen Teich
gefallen ist", sagt Neag Savann (der Ehemann, eine Tochter und zwei Schwestern
liegen in Massengräbern von Pol Pot).
Es scheint die Frau nicht zu stören, daß sie zwischen Stapeln von Schädeln in
dem Dorf Toul Kok lebt. Die Roten Khmer richteten dort in den ersten Tagen nach
ihrem Sieg in Pnom Penh mindestens 30 000 Menschen hin.
„Die Lebenden jagen mir mehr Schrecken ein als die Toten", sagt sie und ist
stolz auf ihren neuen geblümten Sarong, den sie für sechs Hühner erstanden hat.
Die Leute versuchen, die Zeichen der Vergangenheit auszulöschen. Arm wie sie
sind, werfen sie die bequemen billigen Gummisandalen weg, die sie unter Pol Pot
trugen, und ziehen statt dessen die teuren, bunten Plastiksandalen an, die aus
Thailand kommen.
Alles, was jetzt in Kambodscha zum Kauf angeboten wird, kommt aus Thailand über
den „Heng-Samrin-Pfad", wie die Ausländer diesen Weg nennen. Jeden Tag fahren
lange Kolonnen auf Fahrrädern den Weg von Kampong Tscham nach Sisophon nahe der
thailändischen Grenze, alle Fahrer haben Gold in den Taschen versteckt.
Sie kommen zurück mit Zigaretten, Stoffen, Uhren, Batterien, Radios, Sandalen
und Fruchtgetränken. Sie fahren stets in Gruppen. Von 20 hat immer einer ein
Gewehr bei sich.
|
|
„Es gibt viele Banditen, vor allem, wenn wir durch den Wald fahren", sagte einer
von ihnen, den ich an einer „Raststätte" außerhalb von Kampong Thom traf, „und
die größte Gefahr ist, eine Reifenpanne zu haben und alleingelassen zu werden."
Fünf Tage dauert die Hinfahrt, fünf Tage die Rückfahrt, aber der Profit lohnt
das Risiko. Ein Sarong, den man in Sisophon für fünf Dollar einkauft, ist in
Kampong Tscham zehn wert, in Pnom Penh zwischen 13 und 15.
Jeder Radfahrer kann bis zu 40 Kilo transportieren, die meisten Männer auf dem „Heng-Samrin-Pfad"
sind Bauern ohne Reisfelder, Angestellte ohne Arbeit, die allerdings das Glück
hatten, ein Fahrrad zu finden.
Pol Pot hatte alle Fahrräder beschlagnahmt und sie in Lagerhäusern zum Verrotten
gestapelt. Jetzt werden sie, meist ohne Bremsen, für drei Zehntel Unzen Gold
angeboten. Sobald diese Investition gemacht worden ist, läßt sich das Kapital
zur Finanzierung des Pendelverkehrs zwischen der thailändischen Grenze und dem
Zentrum Kambodschas leicht auftreiben.
Viele Menschen, die 1975 ihr Vermögen vergruben, graben es jetzt, da sie
überlebt haben, wieder aus und machen Geschäfte. Eine Unze Gold, die man an
einen Radfahrer zehn Tage lang ausleiht, bringt zehn Prozent Zinsen.
Viele dieser „Bankiers", die von Kampong Tscham und Pnom Penh aus operieren,
sind Überlebende der ehemals 300 000 Menschen starken chinesischen Gemeinde, die
seit Generationen in Kambodscha lebte. „Der Kapitalismus steigt aus der Asche
des zerstörerischen Sozialismus von Pol Pot auf", sagt ein ausländischer Experte
in Pnom Penh.
Die Regierung hat gegen diesen Schwarzhandel nichts unternommen, im Gegenteil,
es scheint, daß sie die Aufrechterhaltung des „Heng-Samrin-Pfades" für
lebensnotwendig hält.
Der ständige Güterstrom kann helfen, den Wert der neuen Währung zu garantieren,
in die die meisten Leute noch kein großes Vertrauen setzen.
Händler, die die Grenze nach Thailand überqueren und Waren auf den Markt nach
Sisophon zurückbringen, nur 28 Kilometer von der Grenze entfernt, müssen den
Thais die Waren in Gold bezahlen.
Gold ist neben der vietnamesischen Währung, dem Dong, immer noch das
willkommenste Zahlungsmittel in ganz Kamputschea. Gold-Wiegemeister ist ein
neuer Beruf, ausgeübt auf den Märkten von Leuten, die mit großer Sorgfalt
Splitter eines Armbandes oder Glieder einer Kette auf kleine Waagen legen. Für
diese Arbeit erhalten sie eine Zigarette vom Käufer und eine vom Verkäufer; ein
ganzes Päckchen ist zwei Kilo Reis wert.
Sisophon, die Endstation des „Heng-Samrin-Pfades" lebt im Goldrausch. Die alte
Stadt, immer noch leer und verfallen, ist von der vietnamesischen Armee besetzt.
In einer früheren Apotheke unterhalten sie ein kleines Gefängnis für
vietnamesische Zivilpersonen, die bei einem Fluchtversuch nach Thailand gefangen
wurden.
Außerhalb der Stadtgrenze, auf einer offenen Ebene ohne den Schatten eines
einzigen Baumes, stehen die Menschen vor Stapeln von Waren, die an schäbigen
Buden aufgebaut sind. Radfahrer laden auf, Leibwächter reicher Kaufleute, die
ihre Pistolen unter dem Hemd versteckt tragen, blicken wachsam in die Runde.
Vietnamesische Offiziere kaufen Stereokassetten, Waisenkinder betteln an den
Ständen, wo man — natürlich für Gold — eine eisgekühlte Coca-Cola bekommen kann.
Es wird noch eine Zeit dauern, bis die kambodschanische Industrie in der Lage
sein wird, die Güter zu liefern, die jetzt thailändische Händler in das Land
schicken und dafür alles Gold aus Kambodscha abziehen.
Von den 80 wichtigsten Industriebetrieben, die Kambodscha 1975 hatte, konnten
weniger als die Hälfte ihre Arbeit wiederaufnehmen, und die nur teilweise. Es
fehlt an Energie, Rohstoffen, Ersatzteilen und Werkzeugen.
„Ohne Hilfe von außen werden sie nie zurechtkommen", hört man ständig von den
ausländischen Experten, die jetzt die kambodschanische Industriestruktur
untersuchen.
Wohin ein Fremder auch kommt, er wird um Hilfe gebeten. „Könnte Ihre Regierung
uns nicht ein paar chinesische Schraubenschlüssel schicken?" fragte mich Hoc Lim
(in seiner Familie wurden 30 Personen getötet), technischer Direktor einer
Textilfabrik in Kampong Tscham.
Sein Bericht über die Fabrik in Kampong Tscham ist ein Beispiel für die
tragische Ironie der jüngsten Geschichte Kambodschas.
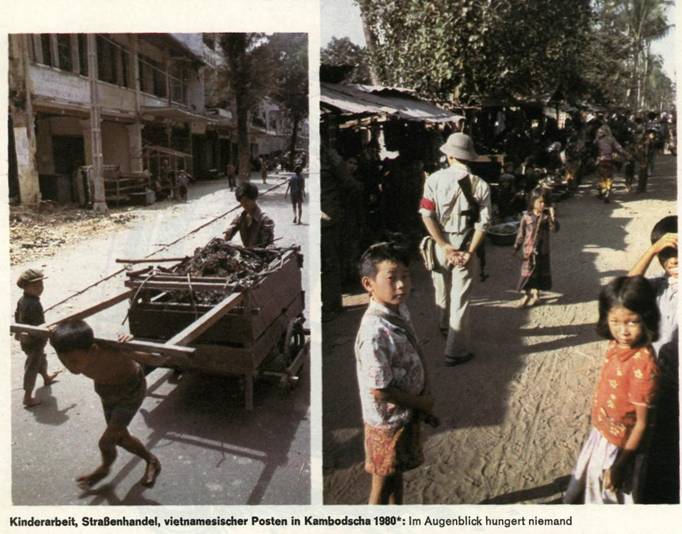
* In Pnom Penh (o. 1.), Battambang (o. r.) und Sisophon (u.).
1960 schenkten die Chinesen die Anlage dem Prinzen Sihanouk, Premier Tschou
En-lai kam zur Eröffnung. 1975 ließ Pol Pot die Fabrik schließen, alle Arbeiter
davonjagen, die Maschinen demontieren.
Im Dezember 1978 wurde die Fabrik wieder geöffnet: vollständig neu, wiederum ein
Geschenk der Chinesen, diesmal an Pol Pot. Gearbeitet wurde nur 26 Tage. Als die
vietnamesische Armee näherrückte, schafften die Pol-Pot-Arbeiter und die
chinesischen Techniker alle Werkzeuge der Fabrik weg, einschließlich der
Schraubenschlüssel, ohne die die Maschinen jetzt nicht angeschlossen werden
können.
Es ist eine der modernsten Textilfabriken, die ich je gesehen habe, aber von 210
Webstühlen arbeiten nur 50, und auch sie werden bald stillstehen, wenn die 72
Tonnen Rohbaumwolle aufgebraucht sind, die von der Unicef gespendet wurden.
Bis 1975 gab es auf 9000 Hektar Baumwollplantagen um Kampong Tscham, jetzt
liegen die Felder brach und trocken in der Sonne. Pol Pot hatte für sie eine
andere Verwendung.
|
|
Nur einen Kilometer von der Textilfabrik entfernt, zu beiden Seiten der Straße,
die zu dem alten Provinzflughafen führt, sind die Felder ein endloser
Schreckensteppich: Schädel, Oberschenkelknochen, Schienbeine und Knochen, soweit
ich sehen kann.
Wie oft habe ich von kambodschanischen Flüchtlingen gehört, die Roten Khmer
hätten Leute abgeführt, die man nie wiedergesehen habe. Hier sind nun die
Abgeholten, namenlose Schädel ohne einen einzigen Kugeleinschuß, darunter viele
winzige Schädel kleiner Kinder.
„Ein Schlag mit der Hacke, ein Schlag mit der Axt, ein Schlag mit dem Stock",
pflegten die Tschhlop zu wispern, um ihre Untertanen darauf vorzubereiten, daß
sie nicht einmal eine Kugel wert seien. Hier sind sie: eingeschlagene Schädel.
50 000 Menschen liegen auf diesen Feldern: Lon-Nol-Soldaten und Beamte mit ihren
Familien, Studenten, Lehrer, Leute, deren Sünde darin bestand, daß sie gebildet
waren.
Warum ist das alles passiert? „Ich arbeite hier, weil ich die Antwort suche. Ich
habe Unmengen Dokumente gelesen, aber keine Antwort gefunden", sagt Ing Pech, 53
(fünf Kinder und zwei Brüder wurden hingerichtet), im Lyzeum Toul Sleng im
südwestlichen Distrikt von Pnom Penh.
|
|
Durch Folterkammern dieses Gebäudes gingen zwischen 1975 und 1978 über 20 000
Kambodschaner — über Eisenbetten, auf denen sie geschlagen und mit
Elektroschocks gequält wurden, durch die winzigen Zellen, wo man sie ohne
Nahrungsmittel in Ketten verhungern und verwesen ließ, darunter
Rote-Khmer-Minister, Botschafter und hohe Funktionäre, die des „Verrats"
angeklagt waren. Ing Pech ist einer von ihnen, man hatte ihn als CIA-Agenten
abgestempelt, aber am Leben gelassen, weil er die Lastwagen reparieren konnte,
mit denen die Roten Khmer ihre Opfer in das Gefängnis brachten.
Am 5. Januar 1979, zwei Tage bevor die vietnamesische Armee in Pnom Penh
einmarschierte, richteten die Tschhlop in aller Eile die verbleibenden Häftlinge
hin, einschließlich zweier Amerikaner, die sie Mitte 1978 auf See gefangen
hatten. Ing Pech gelang es, sich zu verstecken.
„Unser Leben hier war wie ein Haar. Am Morgen ist es noch da, am Abend nicht
mehr. Ich höre noch die Schreie in der Nacht. Manchmal denke ich, ich werde von
diesen Schreien taub. Deshalb habe ich darum gebeten, hier zu arbeiten. So kann
ich zurückkommen, ich kann versuchen, das zu begreifen."
Die Bürokratie des Todes der Roten Khmer hat stapelweise Material
zurückgelassen, das Ing Pech aufarbeitet: 16 000 Akten über Opfer, dutzendweise
Kisten mit Photographien der Menschen, vor und nach der Hinrichtung aufgenommen,
darunter 1200 Bilder von Kindern, einige von ihnen unter zehn Jahre alt. Nichts
geschah hier offenbar ohne Eintragung: Ankunftstag, Geständnisse,
Hinrichtungstag.
|
|
„Lieber Genosse Douch, verschwende nicht soviel Papier. Nimm nur von den
wichtigsten Gefangenen alle Angaben auf. Für die anderen reichen ein paar
Zeilen. Sei vorsichtig bei denen, die lügen. Sei auf der Hut. Mit freundlichen
Grüßen gez. Khieuv", schreibt in einem Brief vom 5. November 1977 der
Pol-Pot-Verteidigungsminister Son Sen (Deckname: Khieuv) an den
Gefängnisdirektor. Er ist auch jetzt noch in der weltweit anerkannten
Rote-Khmer-Regierung Minister.
Der Direktor Douch, der noch bei den Pol-Pot-Streitkräften im Dschungel lebt,
klebte in eine Art Tagebuch ein Bild von sich mit Frau und Kindern ein. Dann
folgen Seite für Seite die Bilder der Folterer und Killer des Lagers.
Mit einem Arbeitsteam von fünf Leuten hat Ing Pech Listen der Hingerichteten
zusammengestellt und mit ihren Bildern in drei Zimmern von Toul Sleng die Wände
bedeckt.
Viele Leute, deren Angehörige von den Roten Khmer „abgeholt" wurden und die
jetzt etwas über ihr Schicksal erfahren wollen, beginnen ihre Suche hier. Mit
weitgeöffneten Augen betrachten sie langsam diese Kataloge des Todes und hoffen,
niemanden wiederzuerkennen.
„Ich höre noch Schreie in der Nacht"
SPIEGEL-Redakteur Tiziano Terzani im zerstörten
Kambodscha (II)
|
|
Von den 1356 Arbeitern, die 1975 in der
Textil-Fabrik Kampong Tscham beschäftigt waren, haben sich nur 410
zurückgemeldet. Von den 37 Technikern haben nur vier überlebt. Magere, blasse
Arbeiter, die ständig zu weinen anfangen, stehen heute an ihrem Arbeitsplatz.
Sie scheinen die Vergangenheit nicht vergessen zu können.
Und: Tschea Tscham Tschea, der Direktor der Textilfabrik, war ein Pol-Pot-Kader
— bis vor zwei Jahren.
Tschea, der immer noch ein schwarzes Hemd und schwarze Hosen trägt, trat als
Bauer 1970 den Roten Khmer bei, er wurde Guerillakämpfer, dann politischer
Kommissar. Nach dem Sieg von 1975 stieg er innerhalb der Roten Khmer weiter auf,
bis zum Mai 1978. Da wurde seine Einheit wie alle anderen Einheiten der
„Militärzone 203", des an Vietnam grenzenden südöstlichen Militärgebiets, in
einen Putsch gegen Pol Pot verwickelt.
Der Aufstand, von Vietnam angestachelt und von So Phim, dem Kommandeur der „Zone
203" angeführt, schlug fehl. Truppen, die Pol Pot ergeben waren, umzingelten die
Rebellen, richteten So Phim hin und brachten auf Pol Pots Befehl systematisch
alle seine Anhänger und deren Familien um.
Tschea gelang es, nach Vietnam zu entkommen. Im Januar 1979 kehrte er im Gefolge
der Invasionstruppen Hanois nach Kambodscha zurück und übernahm die Textilfabrik
in Kampong Tscham im Namen der neuen Regierung.
„Wo waren Sie während der Zeit der Massaker von 1975, 1976 und 1977?" fragte ich
ihn. Alle alten Arbeiter und die vier Techniker, die sich im Zimmer des
Direktors versammelt hatten, bückten verlegen zu Boden.
Die Antwort lag in ihrem ängstlichen Schweigen: Tschea war die ganze Zeit in der
Gegend von Kampong Tscham gewesen und hatte wahrscheinlich auch etwas mit den
Massengräbern an der Straße zum Flughafen zu tun.
„Bis vor zwei Jahren hätte er noch Dünger aus mir gemacht, wenn er gewußt hätte,
was ich war. Jetzt bittet er um meine Mitarbeit", sagte in einer anderen Fabrik
ein Ingenieur. Unter Pol Pot hatte er die Tatsache verheimlicht, daß er als
Student im Ausland gewesen war, und vorgegeben, er sei ein einfacher
Fahrrad-Rikschafahrer gewesen: Sein Direktor war ebenfalls ein Roter Khmer aus
der „Zone 203".
Überall im Kambodscha von heute, in den Fabriken, in den Distrikt- und
Provinzverwaltungen ist die Situation
ähnlich, die Machtstruktur die gleiche: an der Spitze ein oder zwei verläßliche
kommunistische Kader. Unter ihnen aber die Beamten und die Techniker der
früheren antikommunistischen Lon-Nol-Administration, die die Massaker der Roten
Khmer überlebt haben.
Pol Pot hat die Intelligenz des Landes so gründlich vernichtet und seine eigenen
Reihen so systematisch gesäubert, daß den Vietnamesen gar keine große Wahl
blieb, als sie das neue kambodschanische Regime einsetzten. Selbst in die
Zentralregierung mußten sie Leute übernehmen, deren Vergangenheit dubios ist.
Heng Samrin selbst, der Präsident der Volksrepublik Kamputschea, war
bis zum Mai 1978 ein kleiner militärischer Provinzkommandeur der Roten Khmer in
der „Zone 203".
Der Protokolloffizier, der mich zum Interview mit ihm begleitete, war jedoch
derselbe, der mich 1973 in den gleichen Tschamca-Mon-Palast zu Marschall Lon Nol
geführt hatte.
Hung Sen, der 29jährige Außenminister des neuen Regimes, war ebenfalls bis 1978
ein Roter Khmer in der „Zone 203"; aber der wichtige Direktor der ihm
unterstehenden Informationsabteilung kontrollierte in früheren Zeiten als Leiter
der Sicherheitsabteilung am Flughafen Pochentong von Pnom Penh meinen Paß.
Das gleiche gut für alle Ministerien: Außer einigen kommunistischen Ka-
dem an der Spitze arbeiten von den Abteilungsleitern bis hin zu den Fahrern
viele Beamte, die unter dem antikommunistischen Lon-Nol-Regime gearbeitet oder
gar gekämpft haben. So erklärt sich, daß die Regierung Kambodschas heute von
Argwohn und von Angst durchdrungen ist.
|
|
Frühere erbitterte Feinde, Opfer wie Mörder, arbeiten im Namen des Überlebens
der Khmer-Nation zusammen. Aber für wie lange?
„Die Kommunisten benutzen mich, weil sie mich brauchen. In einem oder zwei
Jahren werden sie mich verstoßen", sagt Mok Sakun, dessen Frau, ein Sohn und
zwei Brüder von den Roten Khmer getötet wurden. Er selbst war früher ein
wohlhabender Industrieller in Pnom Penh, jetzt ist er im Handelsministerium
angestellt.
Viele der Intellektuellen und Techniker, die jetzt von der neuen Regierung
beschäftigt werden, denken genauso. Einige fürchten sogar ein schlimmeres
Schicksal, als hinausgeworfen zu werden, und nutzen die augenblickliche
Laschheit in Sicherheitsfragen, um sich abzusetzen.
Im Februar flohen aus einem einzigen Ministerium vier Beamte dieser Herkunft mit
den noch überlebenden Angehörigen ihrer Familien nach Thailand.
Aber nicht nur Nicht-Kommunisten arbeiten jetzt für eine Regierung, die — wie
sie sehr wohl wissen — kommunistisch ist und bleiben will. Nicht nur sie sind
voll Furcht und Argwohn.
Mißtrauen beherrscht auch die Beziehungen unter den hohen kommunistischen
Kadern. Denn sie kommen aus zwei vollständig unterschiedlichen Lagern, die sich
noch bis vor kurzem einen erbitterten Vernichtungskampf lieferten.
Eines Morgens hörte ich zufällig im „Grand Hotel" von Siem Reap einen
politischen Vortrag, den der neue Provinzgouverneur seinen Mitarbeitern hielt.
„Es gibt noch Feinde in unseren Reihen. Es gibt noch Pol-Pot-Agenten, die
versuchen, uns zu vernichten. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen bereit sein,
sie zu vernichten."
Gouverneur Saroeun gehört nicht zu den Überlebenden der „Zone 203". Er war nie
ein Roter Khmer, sondern ein normaler Kommunist, und das schon seit langer Zeit.
1954 hatte er Kambodscha verlassen, er verbrachte die letzten 25 Jahre in
Partei- und Armeeschulen Vietnams.
Im Januar 1979, nach der vietnamesischen Invasion Kambodschas, kehrte er zurück,
um eine der strategisch wichtigsten Regionen zu übernehmen. Er gehört jener
kommunistischen Fraktion an, die Khmer Vietminh heißt, die sich schon immer Pol
Pot widersetzte
* In Pnom Penh.
und das größte Vertrauen Hanois genießt.
Es gab mindestens 5000 Khmer Viet-minh, die in Vietnam geschult und trainiert
wurden, aber Pol Pot nahm zwischen 1973 und 1978 die meisten von ihnen gefangen
und ließ sie hinrichten.
Es gibt nur noch einige hundert Überlebende, wie den Gouverneur von Siem Reap,
aber in ihren Händen befinden sich bereits drei wichtige Ministerien in der
neuen Regierung, einige Schlüsselpositionen in den Provinzen und vor allem die
neue kambodschanische Armee.
Verteidigungsminister ist Pen So-vanh, Sekretär der wiederhergestellten, aber
immer noch geheimen Kommunistischen Partei Kamputscheas, angeblich oberster
Khmer-Vietminh-Führer. Er hat lange Zeit in Vietnam gelebt, in Vietnam studiert
und ist mit einer Vietnamesin verheiratet.
Er ist der „starke Mann" des neuen Regimes, und er gilt als Rivale von Präsident
Heng Samrin für den Fall, daß es zwischen den beiden kommunistischen Fraktionen
zu einer Kraftprobe kommt. Die Khmer Vietminh können für sich geltend machen:
Sie hatten nichts mit den Massakern der Roten Khmer zu tun, und sie waren lange
vor 1978 gegen die mörderische Politik Pol Pots.
„Rote Khmer, Khmer Vietminh, Lon-Nol-Anhänger, Sihanouk-Anhän-ger — sie sind
alle so verschiedener Herkunft, sie hängen so unterschiedlichen Ideologien an,
daß sie nicht vereinigt werden können", sagte in Pnom Penh ein hoher Berater aus
Hanoi.
„Wir Vietnamesen bilden das Bindemittel, welches das Land zusammenhält."
Im Kambodscha von heute sind die Vietnamesen weit mehr als das Bindemittel. Sie
sind alles. Sie sind überall.
200 000 Mann bekämpfen die Reste der Pol-Pot-Anhänger, halten die Zentren aller
verlassenen Provinzstädte besetzt, wandeln die früheren Marktplätze in
Parkplätze für ihre Militärfahrzeuge um. Sie bewachen die wichtigsten
Einrichtungen des Landes, die Brücken, Deiche, Flughäfen und in Pnom Penh die
Hotels, in denen die Ausländer wohnen. Vietnamesische Zivilberater sitzen in
jedem Ministerium, in jeder Abteilung, in jedem Distrikt.
Sogar die Leibwächter Heng Sam-rins sind Vietnamesen. Der Aufseher, der die
Schlüssel des früheren Königspalastes verwahrt, ist Vietnamese, und die
Soldaten, denen Sihanouks Schatzkammer anvertraut ist, sind Vietnamesen. Sie
sitzen unter einem Porträt von Ho Tschi-minh in der Eingangshalle und trinken
Tee. Das Postamt ist ein wichtiger Punkt. Dort arbeitet nur ein einziger
Vietnamese, aber er ist für die „Eingänge und Ausgänge" zuständig.
„Wenn die Kambodschaner ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln können,
werden wir sie das tun lassen", sagt ein vietnamesischer Berater.
Bislang können die Kambodschaner nicht einmal ein Wort am Telephon sprechen,
ohne daß die Vietnamesen die Möglichkeit haben, dabei zuzuhören: Zwischen Pnom
Penh und den Provinzen stellen die vietnamesischen
Militärleitungen die einzige Fernsprechverbindung dar.
Vietnamesisch wird allmählich zur zweiten Sprache Kambodschas. In verschiedenen
Ministerien finden Intensivkurse für Vietnamesisch statt. Die Studenten an der
kürzlich wiedereröffneten medizinischen Fakultät erhalten wöchentlich sechs
Stunden Vietnamesisch.
Vietnamesisch wird zusammen mit Khmer auch auf einigen Hinweisschildern an den
Straßen und außerhalb bestimmter Behörden benutzt. Mein Passierschein, mit dem
ich das Land bereiste, war auf vietnamesisch und französisch ausgestellt.
Obwohl allgegenwärtig, wirkt die vietnamesische Präsenz diskret und nicht
provozierend. Besonders in Pnom Penh zeigen sich die Vietnamesen zurückhaltend.
Ihre Botschaft, die direkt gegenüber der DDR-Vertretung liegt, hat keine Fahne
aufgezogen. Die meisten Spitzenfunktionäre, einschließlich des Botschafters Ngo
Dien, der schon von 1954 bis 1962 in Kambodscha lebte, sprechen Khmer und können
sich wie Kambodschaner benehmen.
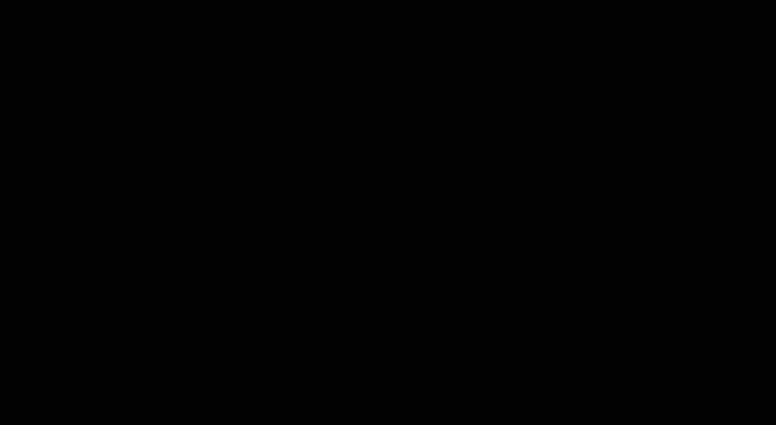
Um Ressentiments bei den Khmer zu vermeiden, haben die vietnamesischen Soldaten
den Befehl, nicht mit der Bevölkerung zu fraternisieren. So ist den Vietnamesen
strikt verboten, Kambodschanerinnen zu heiraten.
Nach Angaben aller Mitarbeiter internationaler Organisationen in Pnom Penh wird
der vom westlichen Ausland für Kambodscha gespendete Reis keineswegs als
Verpflegung für die vietnamesische Armee verwendet. Tag-
lieh kann man auf den Straßen Dutzende alter schäbiger Militärlastwagen sehen,
die Reis für die Besatzungstruppen aus Hanoi bringen.
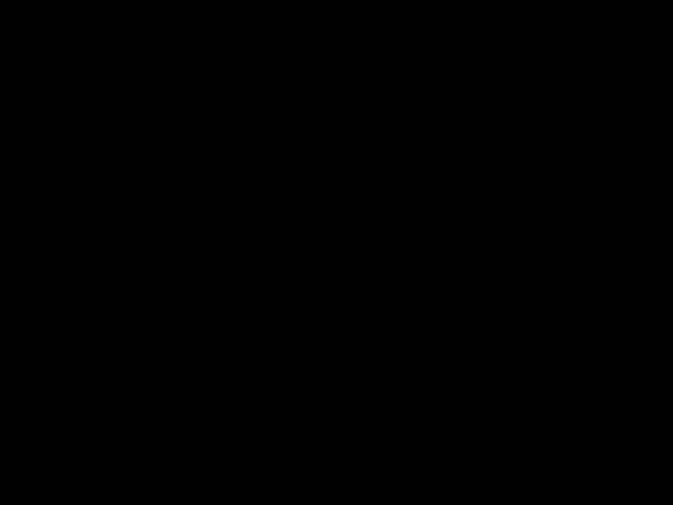
Die Besatzungsarmee versucht, sich möglichst selbst zu versorgen. Überall kann
man vietnamesische Soldaten sehen, die in Gärten an ihren Kasernen ihr eigenes
Gemüse anbauen und in den Flüssen fischen.
Gerüchte, die im Westen kursieren, daß in einigen Teilen des Landes angeblich
Land an vietnamesische Bauern verteilt wird, sind in Kambodscha unbekannt: Ich
fand auch keine Indizien dafür.
Dennoch bleiben die Vietnamesen Ausländer. Obwohl die Kambodschaner nahezu
ausnahmslos zugeben, die Armee Hanois habe sie vor Pol Pot gerettet, keimen in
der Bevölkerung antivietnamesische Gefühle, vor allem in Pnom Penh, wo die
Menschen mit dem wiedergewonnenen Sinn für Sicherheit gern mehr zurückhaben
möchten als nur das nackte Leben.
„Ich habe mich in meinem alten Haus umgesehen und konnte nicht einmal einen
Löffel finden", sagte Tram Sayon (der Vater und zwei Brüder wurden von Pol Pot
getötet). Sie
sprach damit auf die Tatsache an, daß die Vietnamesen nach der Eroberung Pnom
Penhs systematisch alles plünderten, was Pol Pot noch zurückgelassen hatte.
Drei Wochen lang verließen mit Zeltbahnen bedeckte Militärlastwagen Kambodscha
in Richtung Vietnam; beladen mit Radios, Kühlschränken, Motorrädern und allem,
was noch zu verwenden war.
Jetzt behaupten etliche Khmer gern, daß die Autos und Nähmaschinen, die Vietnam
der neuen Regierung spendet, kambodschanisches Beutegut sei, das in Saigon nur
neu angestrichen und zurückgeschickt wurde.
„Hier in Pnom Penh haben einige Leute schon vergessen, daß wir sie gerettet
haben", sagt ein vietnamesischer Berater.
Um das Volk an die Schrecken der Pol-Pot-Zeit zu erinnern, veranstaltet die
Regierung Ausstellungen mit Zeichnungen und Ölgemälden von Überlebenden der
Massengräber und stellt hier und dort große Plakate mit gespenstischen
Hinrichtungsszenen auf.
Die neuen Grundschulbücher Kambodschas, die gerade aus Saigon eingetroffen sind,
enthalten ähnliche Bilder
und ein Kapitel über die Verbrechen der „Pol-Pot-Ieng-Sary-Clique".
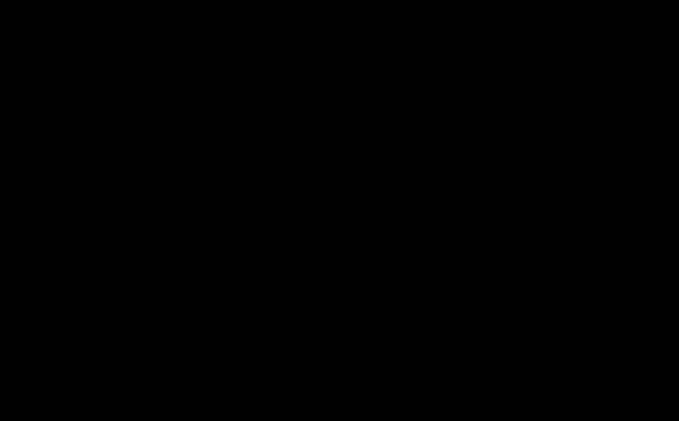
|
|
Auf dem Lande jedoch, wo die Reste der Pol-Pot-Anhänger noch in kleinen Gruppen
im Untergrund lauern, bleiben die Massengräber, die immer noch entdeckt werden,
eine wirkungsvolle Denkstütze für die Notwendigkeit der vietnamesischen
Anwesenheit und ein makabres Abschreckungsmittel gegen jegliche Illusion, die
Truppen aus Hanoi würden sich bald zurückziehen.
„Wir haben unsere eigene Miliz, aber wenn wir zahlenmäßig unterliegen, können
wir die Vietnamesen zu Hilfe rufen. Sie sind nicht weit weg", sagte Heng
Buorseng (der einzige Überlebende einer 12köpfigen Familie), ein Lehrer in Vot
Toul, einem kleinen Dorf an der Autostraße 6, südlich von Kampong Thom.
Nach seinen Angaben leben noch 1000 Rote Khmer in einem nahegelegenen Wald unter
dem Kommando
von Pol Pots Verteidigungsminister Son Sen. Einige hatten sich kürzlich ergeben,
weil sie krank und hungrig waren. 1975 lebten hier 170 Familien, nur drei sind
übriggeblieben. 583 Leute wurden hingerichtet.
Ich muß skeptisch geblickt haben, denn sie luden mich ein, ihnen zu folgen.
Knapp einen Kilometer hinter der Pagode von einst waren zwei große Brunnen mit
Knochen gefüllt.
„Meine Geschwister sind darunter", sagte der Lehrer geistesabwesend. Ein älterer
Mann kam und legte seine Hand gegen meinen Hals, um zu zeigen, wie die Leute
durch einen Stockschlag getötet wurden. Ein anderer fragte mich hysterisch,
warum die Welt
nicht helfe, Pol Pot zu fangen und ihn zu töten.
15 Kilometer weiter hatten die Pol-Pot-Leute ihr Distrikt-Vernichtungsgelände.
Dort wurden am Fluß 50 000 Einwohner getötet, die aus Pnom Penh gekommen waren.
Bis Ende vergangenen Jahres konnten die Bauern von Vot Toul ihre Büffel nicht
zur Tränke führen. Während der Regenzeit war das Wasser schwarz und seifig von
Blut und Bregen. Kambodscha war schon im-
mer ein Land der Legenden und Märchen. Die Natur ist von Geistern belebt.
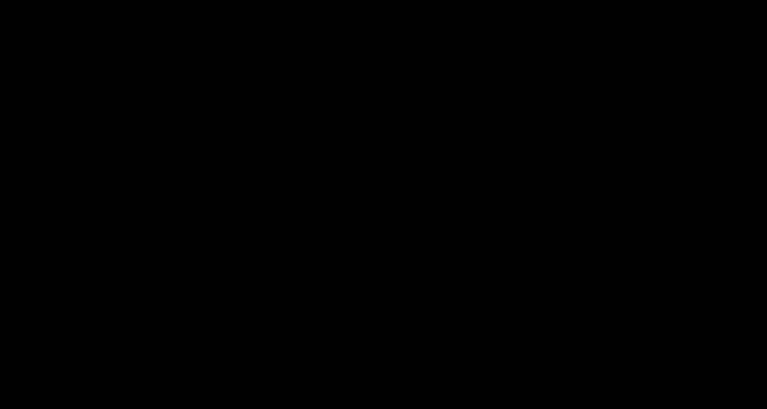
|
|
Von dem künstlichen Hügel in der Mitte Pnom Penhs sagt man, er sei vor
Jahrhunderten von Chinesen über dem „Naga" erbaut worden, der siebenköpfigen
Schlange, dem Symbol der Khmer. Denn der Kaiser hatte angeblich gehört, der Naga
wolle herauskommen und ganz China verschlingen.
Jetzt ranken sich um jeden Fluß, jeden Hügel, jedes Feld, jeden Teich neue
schreckliche Geistergeschichten — wie um jenen Teich in Battambang, in den die
Roten Khmer angeblich ganze Lastwagenladungen mit Menschen warfen, die dann von
Krokodilen zerrissen wurden.
Auf dem abschüssigen Hügel von Kirirom, 12 Kilometer von Battambang entfernt, im
kühlen Schatten einer prächtigen Höhle, lächelt ein riesiger liegender
Steinbuddha mit abwesendem Blick in den Augen. Vor ihm liegen Hunderte verwester
Leichen von Männern, Frauen und Kindern in ihren zerrissenen schwarzen Lumpen.
Ihre Arme sind noch mit Kabeldraht zusammengebunden, sie liegen durcheinander
und übereinander neben den Stöcken und Stangen, mit denen sie zu Tode geprügelt
wurden.
Die Tschhlop hatten ihre Opfer vor den Gott der Barmherzigkeit gebracht, um sie
zu verhöhnen: „Bittet ihn doch um Hilfe. Mal sehen, was er für euch tun kann."
Das selige Lächeln des Buddha war ihr letzter Anblick von der Welt gewesen,
bevor die Stöcke auf ihre Schädel niedersausten.
Man kann noch den kurzen Weg sehen, den die Opfer zurücklegen muß-
ten, wenn sie von der nahe gelegenen Pagode heruntergeführt wurden, die ihr
Gefängnis war.
Durch die Fenster sieht man auf die Ebene, eine der reichsten Regionen
Kambodschas, hier und da vom dunklen Fächer der Zuckerpalmen gesprenkelt.
„Wie kann die Natur so schön sein, wenn ich so verzweifelt bin", hat jemand in
zittriger Schrift mit Holzkohle geschrieben, bevor er zum Sterben geführt wurde.
„Adieu Hügel Kirirom. Auf Nimmerwiedersehen."
Ein anderer, der mit Sen Hong unterschrieb, hat eine Botschaft für eine Frau
hinterlassen: „Ich liebe dich, aber du wirst es niemals erfahren. Denn du bist
ein Stern, und ich bin nur ein Erdenwurm, der zermalmt wird."
„Die Chinesen pflegten zweimal wöchentlich herzukommen, um die Todesarbeit zu
überprüfen", sagt Ing Pech, Forscher im früheren Lyzeum Toul Sleng, in dem an
die 20 000 Opfer gequält und getötet wurden.
Er wiederholt damit die derzeitige Standardpropaganda der Vietnamesen: Die
Chinesen hätten Pol Pot zu den Massakern veranlaßt, sie hätten ihm gar
versprochen, für jeden treulosen Krimer, den er beseitige, 30 „gute Chinesen" zu
schicken, die ihm helfen
würden, ein starkes Kamputschea aufzubauen.
So absurd sie auch klingt, diese Erklärung der Massaker wird im heutigen
Kambodscha ständig wiederholt, man hört sie fast wörtüch von den
unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Teilen des Landes.
Eines ist sicher: Die Chinesen wußten sehr wohl, was unter Pol Pot geschah. Ihre
Botschaft in Pnom Penn, jetzt ein Gästehaus des Verteidigungsministeriums, war
nur einen Block weit entfernt von dem Toul-Sleng-Gefäng-nis. „Sie konnten die
Schreie der gefolterten Menschen hören", behauptet jetzt die Propaganda.
20 000 chinesische Berater waren seinerzeit in Kambodscha. Sie konnten den
Holocaust gar nicht übersehen. Tatsächlich sollen sich einige dieser Berater bei
Chinas Botschafter Sun Hao und sogar beim damaligen Pekinger Politbüro-Mitglied
Wang Tung-hsing über die Massaker beklagt haben. Ihnen sei jedoch bedeutet
worden zu schweigen, weil dieses „eine innere Angelegenheit Kamputscheas" sei.
Jetzt haben die Vietnamesen leichtes Spiel, Pol Pot mit China gleichzusetzen und
den Kambodschanern zu erklären, ohne chinesische Hilfe hätte Pol Pot nie tun
können, was er tat.
Photos von Botschafter Sun Hao mit Ieng Sary und Mao Tse-tung mit Pol Pot werden
von den Vietnamesen verbreitet, die neue Khmer-Regierung greift zum gleichen
Propagandamittel.
Zweifelsfrei steht fest, daß Peking nach der Übernahme Pnom Penhs durch die
kommunistischen Guerillakämpfer im April 1975 seinen Favoriten Pol Pot gegen
gemäßigtere Rote-Khmer-Führer unterstützte. Da die Chinesen Pol Pot für ihren
besten Verbündeten gegen die Vietnamesen hielten — die in Chinas Augen bereits
damals Marionetten der Sowjet-Union waren —, gewährten sie ihm reichlich Hilfe
und lieferten ihm hochentwickelte Waffen.
Über den alten Hafen Kampong Som und den neuen Flughafen Kampong Tschhnang, den
die Chinesen völlig wiederaufbauten, lieferte Peking Pol Pot Panzer,
130-mm-Geschütze und Flugzeuge. „Die Chinesen rüsteten 23 Khmer-Divisionen aus,
um uns anzugreifen", sagte ein hoher Vietnamese in Pnom Penh.
Die Chinesen antworten darauf, diese Waffen hätten den Kambodschanern helfen
sollen, sich gegen vietnamesische Eroberungsversuche zu verteidigen.
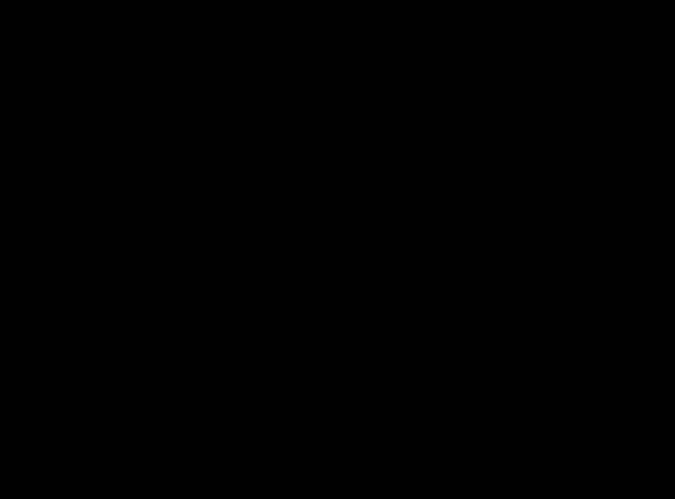
Tatsache bleibt, daß die Pol-Pot-Leute gar nicht in der Lage waren, das
Kriegsmaterial zu verwenden, das sie von China erhielten, und die Vietnamesen
später das meiste unversehrt wiederfanden, manchmal noch verpackt.
Es dient jetzt dazu, die neue pro-vietnamesische kambodschanische Khmer-Armee
auszurüsten. Eine chinesische MiG-17 mit chinesischer Aufschrift und
Pol-Pot-Markierung wurde allerdings ausgespart. Sie ist jetzt vor dem
Nationaltheater in Pnom Penh aufgestellt, zusammen mit anderen chinesischen
Waffen. So sollen die Khmer an den "..chinesischen Plan zur Eroberung
Südostasiens unter Benutzung Kambodschas als Sprungbrett" erinnert werden.
In Kambodscha glauben die Menschen heute alles mögliche. Nach vier Jahren
Massaker, Krankheiten, Hunger und täglichem Terror scheinen die überlebenden
Kambodschaner in keiner Hinsicht normale Menschen zu sein.
„Wissen Sie, daß es in Kambodscha einen Völkermord gegeben hat?" fragte mich
völlig unvermittelt der Zollbeamte Sambath (seine Eltern, zwei Brüder und eine
Schwester wurden unter Pol Pot getötet) am Flughafen Pochen-tong.
Man trifft in Kambodscha heute oft Menschen, mit denen man sich normal
unterhalten kann — bis man feststellt, daß sie in einer Art Trance leben.
„Ich höre die Stimmen", sagte mir eine Frau, „ich höre sie die ganze Zeit. Die
Stimmen der Tschhlop, die da sagen: Dich am Leben zu erhalten ist kein Gewinn,
dich zu beseitigen kein Verlust."
Viele Menschen können die Tatsache nicht verkraften, daß sie überlebt haben. Dr.
Hun Tschhen Ly etwa (fünf Brüder wurden mit ihren Frauen und Kindern ermordet,
seine Frau und zwei Jungen verschwanden), Direktor des Battambang-Krankenhauses,
schluchzt und zittert, als er seine Familiengeschichte erzählt, und entschuldigt
sich bei mir, daß er als einziger am Leben geblieben sei.
Die Menschen fürchten sich vor dem Schlaf, weil sie von Alpträumen gequält
werden.
„Ich träumte, daß Pol Pot zurückgekommen ist, daß die Tschhlop die Kartoffel
entdeckt haben, die ich gestohlen hatte", sagt die Kambodschanerin Long Vanthan
(vier Kinder verhungerten, der Ehemann wurde hingerichtet, weil er nicht eine
Zuckerpalme hinaufklettern konnte und damit bewies, daß er ein Bourgeois war).
Sie war früher Gymnasiallehrerin, jetzt ist sie mit ihrer einzigen überlebenden
Tochter beim „Frauenverband von Kamputschea" angestellt.
Andere quält die Tatsache, daß sie nicht rebellierten, daß sie nicht einmal den
Versuch unternahmen, ihre Angehörigen zu retten. „Sie nahmen meinen Mann mit,
und ich fragte nicht einmal nach dem Grund. Ich wußte, sie hätten mich auch
mitgenommen", sagt eine andere Frau. Und eine weitere: „Ich fürchte mich noch
immer vor Kindern."
Die Tschhlop hatten in vielen Fällen Kinder beauftragt, sich auf Bäumen und
hinter den Hütten der Leute zu verstecken, um deren Gespräche abzuhören und sie
zu denunzieren. Sie hatten gar die Erlaubnis erhalten, sie zu töten. „Die
Gefährlichsten waren die Neun- und Zehnjährigen. Pol Pot hatte ihnen dieses
Spiel beigebracht. Für sie war es das gleiche wie eine Eidechse zu töten oder
einen Schmetterling zu fangen", sagte die Frau.
Manche Kambodschaner scheinen über die Erlebnisse ihre Identität verloren zu
haben. „In meinem nächsten Leben hoffe ich, nicht wieder als Khmer geboren zu
werden", hörte ich während meiner Reise zweimal von verschiedenen Leuten.
Verhuscht, traumatisiert, in ihrem eigenen Land verloren — die Kambodschaner
wirken wie Patienten, die einer psychologischen Massentherapie bedürfen. Statt
dessen werden sie von einer neuen Dampfwalze erfaßt: von Hanois
Propaganda-Maschine.
Jeder Khmer, der für die neue Regierung arbeitet, jeder Student, bald auch jeder
Bürger, nimmt an der vietnamesischen „Umerziehung" teil.
Die Dauer der Kurse schwankt von drei Tagen bis zu acht Monaten mit einer
Endstufe in Hanoi für die hohen Funktionäre. Der Inhalt der Kurse ist bei
gewisser Differenzierung für alle gleich:
> Marxismus-Leninismus;
> Geschichte der indochinesischen Revolution;
> Analyse des Pol-Pot-Regimes;
> Rechtfertigung der vietnamesischen Präsenz in Kambodscha.
„Die augenblickliche Situation ist unabänderlich", sagt man den Khmer und
schreckt sie mit der Behauptung: „Jede Alternative zu dem augenblicklichen
Regime bedeutet die Rückkehr Pol Pots."
„Die drei Völker Indochinas müssen sich gegen die chinesischen Imperialisten und
Reaktionäre vereinigen, denn sie sind wie die Beine eines Dreifußes, der einen
Topf über dem Feuer hält. Wenn ein Bein schwächer ist oder bricht, kippt der
Topf um", bekommen die Kambodschaner in den politischen Kursen zu hören.
Das Ergebnis ist durchschlagend: Menschen verschiedener Herkunft und Erziehung
aus den verschiedensten Gegenden des Landes wiederholen die Parolen wie
Papageien: Die Kurse werden bewertet, und diejenigen mit den besten Noten
erhalten die besten Arbeitsplätze.
Prinzessin Sisovath Sorithivong Monivong — sie hat ihren Mann und drei Kinder
verloren —, der ihr Vetter Prinz Sihanouk den Spitznamen „Lola" (Khmer-Ausdruck
für Quatschtante) gegeben hatte, wurde zum Mitglied der „Vereinigten Front für
die nationale Rettung" ernannt. Sie referiert jetzt über Marxismus-Leninismus
mit der gleichen Geläufigkeit, wie sie bis 1975 über die Gefahr des Kommunismus
zu sprechen pflegte:
„Die Vietnamesen sind hier, um unseren Schlaf zu schützen. Es ist besser, wenn
sie bleiben, denn wir brauchen eine lange Zeit, um den Baum wieder wachsen zu
lassen, den Pol Pot abgehackt hat."
Hochwürden Tep Veng, der neue Leiter der wiedererstandenen buddhistischen
Kirche, hat nur 15 Tage an der „Umerziehung" teilgenommen, aber sie reichten
aus, um ihn davon zu überzeugen, daß Buddhismus und Sozialismus die gleichen
Werte hegen, daß sie „Wasser der gleichen Quelle" sind. Ein Besuch in Moskau hat
ihn überzeugt, daß es in der Sowjet-Union große Religionsfreiheit gibt.
1975 amtierten 28 000 hauptamtliche buddhistische Priester in Kambodscha. Nur
800 sind wieder aufgetaucht, der Nachwuchs wird von Mönchen ordiniert, die aus
Vietnam kommen.
So hat es denn den Anschein, daß sogar der Buddhismus in Kambodscha zu seiner
Wiedergeburt die Berater aus Hanoi braucht.
Die religiöse Wiederbelebung jedoch scheint spontan und echt. Bauern suchen aus
den Schutthaufen Stücke zerbrochener Buddha-Statuen und leimen sie wieder
zusammen. Mütter hängen ihren Kindern handgemachte Buddha-Amuletts um den Hals.
Über den alten, von den Roten Khmer zerstörten Pagoden stellen die Menschen
Strohdächer auf, errichten einfache Altäre und kommen wieder zum Gebet.
Pol Pot war, wie die meisten Kambodschaner, als Kind in einer Pagode erzogen
worden. Später, als Parteichef, ordnete er die systematische Zerstörung der
Pagoden an, ließ Tausende von Bonzen hinrichten und zwang die überlebenden, die
Kutte abzulegen und zu heiraten.
Der Aberglaube ist immer noch wesentlicher Bestandteil des kambodschanischen
Lebens. Viele Menschen, vor allem auf dem Lande, glauben daher, Pol Pot sei die
Strafe gewesen, die das Volk der Khmer für ein sündhaftes Leben verdient hätte.
Nach einer alten Prophezeiung waren die Khmer gewarnt worden, daß ihr Land durch
einen großen Krieg verwüstet werde, auf den eine Zeit der „schwarzen Krähen"
folge. Danach werde eine Armee aus dem Osten das Land besetzen. Die Bezeichnung
„schwarze Krähen" paßt auf die ganz in Schwarz gekleideten Roten Khmer, während
die östlichen Invasoren die Vietnamesen sein könnten.
„Ich wußte, daß die Roten Khmer erledigt waren, als ich nachts im Wald von
Pursat die Vögel ,ah Pol Pot, ah Pol Pot' schreien hörte", sagte mir allen
Ernstes ein ehemaliger Jurastudent, der jetzt wieder in Pnom Penh arbeitet, „und
ich begriff, daß unser Sühnen vorbei war." „Ah" bedeutet in der Khmer-Sprache
„verdammt".
„Ich höre noch Schreie in der Nacht"
SPIEGEL-Redakteur Tiziano Terzani im zerstörten Kambodscha
(III)
Das Kambodscha Pol Pots, das als erstes Land das Geld abschaffte und
als erstes Regime der Welt einen so großen Teil seiner eigenen Bevölkerung
tötete, war wie die Roten Khmer selbst so einmalig und ohne Beispiel, daß über
dieses Regime immer noch zutiefst widersprüchliche Meinungen herrschen.
„Wir wollen etwas verwirklichen, das es noch nie gegeben hat", bekannte der
damalige Außenminister Ieng Sary 1977 in einem SPIEGEL-Interview.
Pol Pot war in erster Linie Revolutionär. Wie andere Revolutionäre wollte er
eine neue Gesellschaft aufbauen und glaubte, dieses Ziel nur erreichen zu
können, wenn es den Roten Khmer gelang, einen „neuen Menschen" zu schaffen. Der
kürzeste Weg zur Verwirklichung dieses in der kommunistischen Welt schon
mehrfach beschworenen Zieles war in den Augen der Roten Khmer die sofortige
systematische Ausrottung alles Alten.
Als die siegreichen Revolutionäre am 17. April 1975 Pnom Penh einnahmen, hatte
der größte Teil der kambodschanischen Bevölkerung die fünf Kriegsjahre unter dem
antikommunistischen, proamerikanischen Lon-Nol-Regime gelebt. Etwa zwei
Millionen Kambodschaner der damals sieben bis acht Millionen Kambodschaner
lebten in den von den Roten Khmer kontrollierten Gebieten.
Diese Menschen sollten für eine neue Gesellschaft erhalten bleiben. Die anderen,
in den Augen Pol Pots von westlichen, dekadenten, bürgerlichen Werten infiziert,
mußten liquidiert werden — aber nicht sofort.
Zunächst sollten sie noch als Arbeitskräfte die Infrastruktur des neuen
Kambodscha errichten helfen. So wurde die Stadtbevölkerung denn aufs Land
deportiert und bei den Bewässerungsarbeiten eingesetzt.
In der ersten Welle der Massaker, unmittelbar nach ihrem Sieg, richteten die
Roten Khmer nur die erkannten Kader vergangener Regime hin: Offiziere und
Zivilbeamte Lon Nols und hohe Bonzen, später gefolgt von Soldaten, Lehrern,
kleinen Beamten und allen, die auch nur den geringsten Widerstand leisteten.
Um aber eine neue Gesellschaft ohne Bezug auf die Vergangenheit errichten zu
können, mußte Pol Pot nach seiner Auffassung jeden vernichten, der die
Vergangenheit wieder hätte aufleben lassen können. Auch meinte er, die
Mechanismen zerschlagen zu müssen, durch die jede Gesellschaft ihre Werte
überträgt. Nur so hoffte er, die gemeinsame Erinnerung an die Vergangenheit
auszulöschen.
Daher wurden sämtliche Schulen geschlossen, Kirchen und Pagoden wie auch alle
Bibliotheken zerstört, Bücher verbrannt, Lehrer, Mönche, Intellektuelle
hingerichtet; theoretisch jeder, der lesen und schreiben konnte und dadurch
Träger jener ansteckenden Krankheit war, die Vergangenheit hieß.
Als dieser Plan konkret wurde, regte sich unter den Roten Khmer selbst offenbar
starker Widerstand, so daß Pol Pot in seinen eigenen Reihen Säuberungen
durchführte. Auf einem Treffen in Stung Treng im März 1975, auf dem die
Evakuierung aller Städte beschlossen wurde, sprach sich Hou Youn, Pol Pots
Innenminister und angesehener Revolutionär der ersten Stunde, gegen diesen Plan
aus. Pol Pot trieb seinen Genossen in den Selbstmord und ließ seine Familie
hinrichten.
|
|
Im April 1977 opponierte Hou Nim, Pol Pots Informationsminister, ebenfalls ein
alter Revolutionär, gegen die Politik des Massenmordes. Er wurde verhaftet und
im Gefängnis Toul Sleng gefoltert. Dort beging er Selbstmord, indem er sich die
Pulsadern mit einem zerbrochenen Löffel durchschnitt. Auch Pol Pots Minister für
öffentliche Bauten wurde dem Henker übergeben.
Inzwischen suchten Pol-Pot-feindli-che Kader der Roten Khmer in Vietnam Hilfe.
Verschiedene — gescheiterte — Putschversuche gegen Pol Pot, schon in den ersten
Monaten nach dem Sieg, wurden offenbar bereits von Hanoi unterstützt.
Nach jedem Putsch entsandte Pol Pot unter dem Befehl seines Hauptgehilfen Ta Mok,
der heute noch mit seinem Chef im Dschungel kämpft, ihm absolut ergebene Truppen
zur Eliminierung aller Roten Khmer, einschließlich ihrer Familien, die in dem
Verdacht standen, an den Verschwörungen teilgenommen zu haben.
Auf diese Weise wurden Tausende alter Revolutionäre ebenso wie junge Guerillas
liquidiert und häufig in die gleichen Massengräber geworfen, in die sie selbst
zuvor die Körper ihrer Opfer aus den Städten gestoßen hatten.
Wieviel dieses perverse Experiment an Menschenleben gekostet hat, wird nie
bekannt werden. Angesichts der Tatsache jedoch, daß es in Kambodscha heute wohl
keinen Menschen gibt, der nicht einige Familienangehörige verloren hat,
angesichts der Tatsache auch, daß fast jedes Dorf sein Gefängnis und seinen
Hinrichtungsort hatte, daß man überall auf Massengräber und Knochenfelder stößt,
scheint die Zahl von drei Millionen zwischen 1975 und 1978 getöteten oder
verhungerten Kambodschanern kaum übertrieben zu sein.
Nach Schätzungen der Vertreter der internationalen Organisationen, die sich in
Pnom Penh jetzt bemühen, die ausländischen HUfsgüter in die richtigen Kanäle zu
leiten, leben noch etwa vier Millionen Kambodschaner im Lande.
Diese vier Millionen zuzüglich der wenigen tausend Kambodschaner, die bereits
ins Ausland geflohen sind, und der 800 000 Menschen, die jetzt in
Flüchtlingslagern in Thailand oder entlang der thailändisch-kambodschanischen
Grenze vegetieren, sind von den sieben bis acht Millionen Khmer des Jahres 1975
übriggeblieben.
* In diesem Licht scheint es geradezu zynisch, daß die Uno-Mehrheit und mit ihr
der Westen in gerechter Empörung gegen die vietnamesische, von Moskau gestützte
Invasion das Pol-Pot-Regime auch heute noch als legitime Regierung Kambodschas
anerkennt und in seinem Uno-Sitz bestätigt — durch Votum beispielsweise auch der
Regierungen Jimmy Carter und Helmut Schmidt.
Wäre Vietnam nicht in Kambodscha eingefallen, hätte es das Regime der Roten
Khmer nicht gestürzt, wäre Pol Pots blutiges Experiment, einen „neuen Menschen"
zu schaffen, fortgesetzt worden — zumindest wären die Massaker weitergegangen.
Die meisten seiner Soldaten, zumindest die Tschhlop, verkörperten den neuen
Menschentyp bereits. Es waren oft zehnjährige Kinder, von den Überlebenden heute
als die schlimmsten Mörder bezeichnet. Sie sind Kinder, die unter der Herrschaft
der Roten Khmer heranwuchsen, über das traditionelle Kambodscha nichts oder nur
wenig wußten, die keine Gelegenheit hatten, wie Kinder zu leben und zu spielen,
und kein anderes Spiel kannten als das von Krieg und Mord.
In seiner selbstgewählten Isolation von der übrigen Welt hätte das Kambodscha
Pol Pots weiterhin an der Schaffung dieses sogenannten neuen Menschen arbeiten
können. In zwanzig Jahren dann wäre die blutig erträumte „neue Gesellschaft"
vielleicht Realität gewesen.
Die Rasse der Khmer, seit den Tagen Angkors geschwächt, in den Augen Pol Pots
durch Mischehen mit Vietnamesen und Chinesen entartet und durch die
französischen Kolonialherren und amerikanischen Imperialisten korrumpiert, wäre
— so der Wahn der Führer der Roten Khmer — in einer reinen, starken Rasse
wiederauferstanden, gestählt durch die makabre pseudo-darwinistische Auswahl der
Massaker — gewiß eine fürchterliche Vorstellung.
So aber wurde Pol Pots grausiges Experiment durch die Invasion der Vietnamesen
beendet. Unterstützt wurden die Invasoren dabei von einer kleinen Armee
ehemaliger Roter Khmer aus der „Militärzone 203", die gegen Pol Pots Methoden
opponiert hatten und nach Vietnam geflüchtet waren — etwa 10 000 bis 15 000
Kambodschaner. Pol Pot mußte sich in den Dschungel zurückziehen.
Innerhalb eines Jahres haben die Vietnamesen die völlige militärische Kontrolle
über Kambodscha errungen. Die von ihnen eingesetzte neue kambodschanische
Regierung unter Heng Samrin hat sich in jeder Stadt, jedem Bezirk und jedem Dorf
des Landes durchgesetzt.
Auf die Dschungelgebiete entlang der thailändischen Grenze beschränkt, wo er
Zugang zu Lebensmitteln und Waffen hat, führt Pol Pot jetzt einen Guerillakrieg
„gegen die vietnamesischen Invasoren und ihre Marionetten".
Er verfügt noch — laut den Vietnamesen — über etwa 15 000 treue Soldaten,
Überreste seiner Armee und seiner „neuen Menschen", die im Kardamom-Gebirge im
westlichen Kambodscha kämpfen, und über einige hundert Mann, die hier und da
sporadisch Unsicherheit schaffen.
|
|
|
|
In Angkor wurde mir gesagt, ich solle mich nicht außerhalb der großen Tempel
bewegen. Zwischen Kampong Tscham und Kampong Thom, dem Geburtsort Pol Pots,
wurde mir geraten, nicht den kürzeren Weg durch den Gebirgswald zu benutzen,
sondern lieber den längeren über die offene Ebene. In Skoun stieß ich auf zwei
Unicef-Lkws, die von „Banditen" ausgeraubt und in Brand gesteckt worden waren.
Während meines ganzen Aufenthalts in Kambodscha jedoch sah und hörte ich nichts
von den großen Kämpfen, die die Roten Khmer nach ihren Rundfunkmeldungen aus
China den Vietnamesen angeblich liefern.
Andererseits sah ich auch keinerlei Anzeichen jener großen Offensive der
vietnamesischen Armee gegen die Rest-Streitkräfte Pol Pots entlang der Grenze,
mit der noch vor Ende der Trok-kenzeit gerechnet wird.
„Warum sollten sie ihn verfolgen?" fragte ein Uno-Beamter in Pnom Penh. Den
Vietnamesen nützt Pol Pot, denn solange er da ist, um die Menschen durch die
Möglichkeit seiner Rückkehr an die Macht in Angst und Schrecken zu versetzen,
haben die Vietnamesen eine gute Rechtfertigung für ihre Anwesenheit in
Kambodscha." Dieses Argument enthält eine gewisse Logik, denn Pol Pot kann dem
neuen Regime faktisch nicht mehr gefährlich werden.
Durch ihre Invasion haben die Vietnamesen die überlebenden Kambodschaner von den
Schrecken des Terrors befreit. Sie haben aber auch die soziale und
wirtschaftliche Struktur zerstört, über die Pol Pot verfügte.
Seine Arbeitskommunen wurden aufgelöst. Selbst seine Modelldörfer, für die Elite
der Roten Khmer in Form langer Reihen von Pfahlbauten, alle in der gleichen Höhe
und Größe errichtet, liegen wie leere Konzentrationslager verlassen in der
Landschaft.
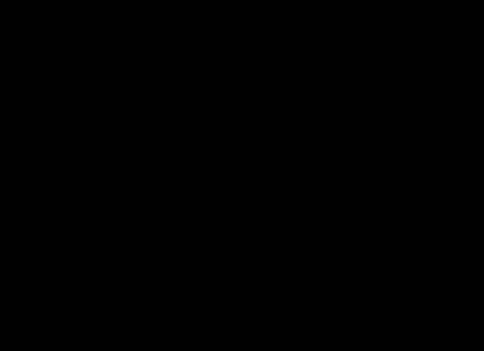 |
|
|
| * Links: Aus einer Ausstellung im ehemaligen Gefängnis Toul Sleng über die Folter- und Hinrichtungspraktiken der Roten Khmer; rechts: Buddhistischer Mönch, der das Haus einer zurückgekehrten Familie segnet. | ||
Die Menschen kehrten lieber in ihre ursprünglichen Dörfer zurück, um dort ihre
angestammten Hütten wiederaufzubauen. Gewiß war Pol Pot bis 1975 in den
ländlichen Gebieten, die er seit langem kontrollierte, massiv unterstützt
worden. Doch selbst diese Unterstützung schwand mit den zunehmenden Säuberungen
und Massakern.
Die älteren Dorfbewohner haben, auch sofern sie Rote Khmer waren, wie andere
Kambodschaner unter Pol Pot gelitten: Sie haben ihre Verwandten verloren, die
als Stadtbewohner getötet wurden; sie haben ihre Kinder verloren, die als
angebliche Mitglieder Pol-Pot-feindlicher Einheiten der Roten Khmer hingerichtet
wurden.
Pol Pot muß jetzt einen Guerillakrieg ohne Unterstützung der Bevölkerung führen,
ein hoffnungsloses Unterfangen. „Pol Pot hat die Lehre Maos nicht begriffen",
sagt ein ausländischer Beobachter. „Statt ein Fisch im Wasser zu sein, trank er
das Wasser aus."
Die Roten Khmer werden aber immer noch vor allem durch China unterstützt.
Vergangenen Monat wurde Khieu Samphan in Peking mit den Ehren eines
Staatsoberhaupts empfangen. Er hat Pol Pot an der Spitze der Regierung der Roten
Khmer abgelöst; ein kosmetischer Versuch, einem Regime wieder Glaubwürdigkeit zu
verleihen, das durch seine mörderische Politik bekannt wurde. Pol Pot ist aber
noch Chef von Partei und Armee.
Hua Kuo-feng, der chinesische Parteichef, sicherte seinem Gast Khieu Samphan
weitere Militärhilfe zu. Der chinesische Verbindungsweg zu den Roten Khmer führt
durch Thailand, obwohl Bangkok behauptet, sich in diesem Konflikt neutral zu
verhalten.
„Fünf Tage lang zogen wir durch den Dschungel. An der thailändischen Grenze
schlugen wir ein Lager auf und warteten", erinnert sich Kaem That, 24, Soldat
der Roten Khmer, den ich zufällig im Krankenhaus von Battambang traf. Er hatte
sich den Vietnamesen ergeben, schwer krank von Malaria und starker
Unterernährung.
Er berichtete weiter: „Zunächst trafen die zivilen Lkw ein und luden Reis ab.
Unser Führer bezahlte in Gold. Dann kamen die militärischen Lkw und luden
schwere Kisten mit Waffen und Munition ab. Unser Führer bezahlte mit einem Teil
des Reises, den wir zuvor gekauft hatten."
Kaem Thats Einheit stellte den Nachschubverkehr zwischen Thailand und den Basen
Pol Pots im Dschungel sicher. Nach seinen Aussagen sind die Händler, die den
Roten Khmer Reis verkaufen, Auslandschinesen aus Bangkok, die Militärs aber, die
ihnen Waffen verkaufen, Thais. Den Reis haben internationale Organisationen für
Flüchtlinge gespendet, die Waffen, die eigentlich kostenlos an die Roten Khmer
geliefert werden sollten, kommen aus China.
„Die breite Masse der Roten Khmer war, wie jeder andere Kambodschaner auch,
Opfer Pol Pots", sagt Kong That, Mitglied der Provinzverwaltung von Battambang,
während er die Regierungspolitik der nationalen Aussöhnung gegenüber jenen Roten
Khmer erläutert, die sich ergeben haben. Er selbst hat drei Brüder und einen
Sohn verloren — von Pol Pot hingerichtet.
Die Versöhnungspolitik sorgt gelegentlich für Überraschungen. Rim Rom, mein
Dolmetscher, war entsetzt, als er auf einem Markt in Pnom Penh jenen Roten Khmer
traf, der in Rim Roms Dschungeldorf in der Terrorzeit dort Sicherheitschef war.
Der Mann entschuldigte sich für alles, was er getan hatte, und schimpfte
erbittert über Pol Pot, der, wie er sagte, für den Tod seines Vaters
verantwortlich sei. Rim Rom erklärte mir später, in Wahrheit habe der
Sicherheitschef damals seinen Vater selbst getötet, weil er „noch an die
Religion glaubte".
In ein Dorf in der Provinz Pursat mußten die Behörden eine Milizeinheit
entsenden, um eine junge Frau zu schützen, die von den Dorfbewohnern gelyncht
werden sollte. Sie war eine der gemeinsten Tschhlop gewesen, sie hatte oft damit
geprahlt, eigenhändig über tausend Menschen getötet zu haben. „Warum wollt ihr
sie töten? Sie kann doch noch Khmer-Kinder gebären", sagten die Soldaten den
Dorfbewohnern. Die Frau lebt noch.
|
|
„Wenn wir anfangen, gegenseitig unsere Vergangenheit zu durchleuchten, werden
wir uns wieder gegenseitig töten. Am Ende wird es in Kambodscha dann nur noch
Vietnamesen geben", erläuterte mir ein Khmer-Beamter in Kandal die
Aussöhnungspolitik.
Da das Überleben Kambodschas unter vietnamesischem Schutz gesichert ist, fördert
die Regierung Heng Samrin das Wiederaufleben der traditionellen Khmer-Kultur,
die Pol Pot zu vernichten versucht hatte.
Die alte königliche Ballettschule wurde wiedereröffnet. Im Institut der Schönen
Künste in der Nähe des Museums von Pnom Penh haben die Studenten begonnen,
Gemälde zu reproduzieren. Radio Pnom Penh sendet wieder die alte monotone
Khmer-Musik, die vier Jahre lang nicht zu hören war.
Diese Zeichen der Restauration bedeuten jedoch nicht die uneingeschränkte
Wiederherstellung der Khmer-Gesell-schaft der Vorkriegszeit. Die Bauern dürfen
zwar in ihre Dörfer zurückkehren, die Reisfelder aber, die sie einst besaßen,
sind nicht mehr ihr Eigentum. Auf den wiedereröffneten Märkten floriert das
private Geschäft, doch den Menschen wird immer wieder klargemacht, daß dies nur
ein Übergang sei, bis die staatlichen Läden, die jetzt eingeführt werden,
ordnungsgemäß funktionieren.
Kambodscha ist und bleibt ein kommunistisches Land, und die vietnamesischen
Kommunisten werden dafür sorgen, daß sich ihre an Moskau orientierte
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durchsetzt und sich der politische Kurs
des Landes nicht grundsätzlich ändert. Darüber macht sich niemand Illusionen.
„Ein weißes Hemd kann man schwarz färben, ein schwarzes jedoch nicht wieder weiß
waschen", sagt ein Student der neuen medizinischen Fakultät. Er brachte damit
die Resignation vieler Intellektueller und Techniker zum Ausdruck, die für das
Regime arbeiten, aber mit dessen Politik nicht einverstanden sind.
Würden die heute noch lebenden Kambodschaner gefragt werden, was sie möchten,
würden die meisten, die französisch sprechen, wahrscheinlich nach Frankreich
gehen wollen, diejenigen, die englisch sprechen, am liebsten in die Vereinigten
Staaten, nach Kanada oder Australien auswandern.
Die meisten anderen, vor allem die Landbevölkerung, würde zu den alten Zeiten
zurückkehren wollen, als Kambodscha noch neutral und nicht in den Krieg
verwickelt war, als niemand hungerte und Sihanouk in ihren Augen ein gütiger
Diktator war. Seine Porträts, jetzt aus Kehrichthaufen aufgelesen, muten wie die
Vision einer sehr fernen Ära an.
Niemand jedoch wird die Khmer ernsthaft fragen, was sie wollen. Die Geschichte
der letzten zehn Jahre — der Putsch gegen Sihanouk, die verheerenden
amerikanischen Bombenangriffe, der erbarmungslose Bürgerkrieg mit dem Massenmord
Pol Pots und der vietnamesischen Befreiung — hat gegen sie entschieden. Ebenso
die Geographie.
Die Vietnamesen sind entschlossen, in der einen oder anderen Form in Kambodscha
zu bleiben — nicht unbedingt, weil die Sowjets ihnen das in Verfolgung der
Moskauer Hegemoniepläne befohlen hätten — sowjetische Präsenz in Kambodscha
beschränkt sich auf einige Ärzte und Experten —, sondern weil es von jeher ein
alter vietnamesischer Traum war, ganz Judochi-na zu beherrschen. Dank der
Politik des Kambodschaners Pol Pot wurde die Verwirklichung dieses
vietnamesischen Traums jetzt erleichtert.
Die Vietnamesen sind nach Kambodscha als „Befreier" gekommen. Unter ihrer
Besatzung haben die Khmer wieder ein normales Leben begonnen.
„Es ist vielleicht nicht die ideale Lösung, doch jetzt nach einer anderen zu
suchen, würde nur weitere Tragödien für diese Menschen bedeuten", sagt ein
Amerikaner, der in Pnom Penh für eine religiöse Hilfsorganisation arbeitet.
„Diese Menschen hatten nicht die Kraft, vor den Massengräbern zu rebellieren.
Wie sollten sie sich jetzt gegen die Vietnamesen wenden, die sie retteten?"
|
|
Zur Zeit beschränkt sich der Widerstand gegen die Vietnamesen auf Witze und
Gerüchte, die sich die Kambodschaner gegenseitig zuflüstern. Gegenwärtig macht
die Anekdote die Runde, daß in einer zerstörten Pagode in Kratie ein altes
Manuskript mit der heute aktuellen Prophezeiung gefunden wurde, die besagt, daß
nach der Ära der ,.scbwarzen Krähen und nach der Besetzung durch die östliche
Armee eine Armee aus dem Westen kommen werde, die wieder einen jungen
buddhistischen König auf den Thron setzen wird".
In Pursat berichten einige Bauern, sie hätten nachts die Vögel „Ah Joun, ah Joun"
(verdammte Vietnamesen, verdammte Vietnamesen) singen hören.
Den Vietnamesen und der Regierung Heng Samrin jedoch machen zur Zeit die Stimmen
anderer Tiere weit mehr zu schaffen. In den klaren Nächten quaken Abertausende
von Fröschen und künden damit das Nahen der Monsunzeit an. Mit Beginn der
Regenzeit müssen die Bauern auf die Reisfelder gehen und die Saat für die große
Ernte einpflanzen. Viele aber haben kein Saatgut.
Kambodscha braucht bis Ende Mai mindestens 60 000 Tonnen Saatgut. Kambodscha
braucht alles und jedes. Die Fabriken liegen brach, weil es keinen Treibstoff,
keine Ersatzteile, keine Rohstoffe gibt. In den wiedereröffneten Schulen sitzen
die Kinder auf dem Fußboden.
„Wenn Sie uns helfen wollen, schicken Sie uns ein paar Nägel, damit wir Bänke
zimmern können", sagte mir ein Lehrer außerhalb Pnom Penhs.
Das Hauptproblem Kambodschas heißt mithin: überleben. So spielen die Vietnamesen
denn auch ihr Argument gut aus: „Wenn ihr leben wollt, seid ihr auf unsere
Anwesenheit angewiesen. Wenn wir gehen, kehrt Pol Pot zurück."
Gerüchte, die in Pnom Penh kursieren, zeigen, daß im Khmer-Volk immer noch die
traditionellen antivietnamesischen Gefühle schlummern und mühelos wiedererweckt
werden könnten: Aus Hanoi sind angeblich tausend Handschellen zur Vorbereitung
von Massenverhaftungen eingetroffen. Und in der Tak-La-Pagode nahe dem Flughafen
sollen die Vietnamesen eine Guillotine für die Hinrichtung Hanoi-feindlicher
Kambodschaner aufgestellt haben.
Dieses Gerücht wurde von der Regierung selbst inzwischen so ernst genommen, daß
Außenminister Hung Sen es auf höchster Ebene diskutierte und zwei
Vertrauensleute in die Pagode schickte, um den Sachverhalt zu überprüfen. Deren
Bericht wurde freudig aufgenommen: Eine Guillotine war nirgends zu sehen.
In Angkor Wat zeigt eines der größten Basreliefs einen Mann, der zu Beginn
seines Lebens zwischen zwei Pfaden zu wählen hat: der eine führt zum Himmel, der
andere zur Hölle.
„Über dieses Stadium sind wir längst hinaus", erklärte mir eine Khmer-Frau, der
aus ihrer sechsköpfigen Familie nur noch eine Tochter geblieben war. „Wir
stecken tief in der Hölle. Wir haben nur zwischen zwei Todesarten zu wählen.
Gehen wir in den Wald, werden wir vom Tiger gefressen. Gehen wir in den Fluß,
zerreißt uns das Krokodil."
Ende